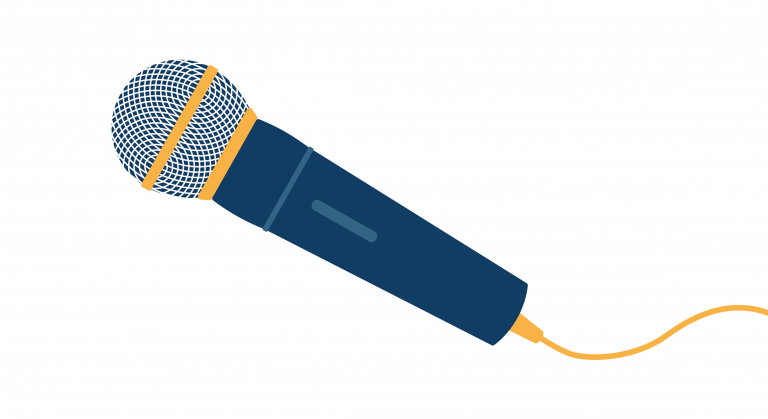
„Null-Toleranz-Botschaften sind leere Schlagworte”
Oliver Scheiber im Interview zur Lage der Justiz und Reform des Strafrechts.
Strafverschärfungen sollen den Gewaltschutz fördern. Doch wie wirksam ist diese Herangehensweise wirklich? Valentina Klemen und Ricardo Parger trafen den Strafrichter Oliver Scheiber, um über die tägliche Praxis bei Gericht, die geplante Strafrechtsreform sowie über den gesellschaftlichen Umgang mit Gewalt zu sprechen.
Parger: Herr Scheiber, Sie sind nicht nur Gerichtsvorsteher an einem Bezirksgericht in Wien, sondern engagieren sich auch außerhalb dieser Tätigkeit. Inwiefern dürfen oder sollen sich Richter öffentlich politisch äußern?
Scheiber: Wenn ich bei mir persönlich beginne, dann war zivilgesellschaftliches Engagement stets ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit und meines Agierens. Selbstverständlich erfordert der Richterberuf eine Menge besonderer Verpflichtungen und Rücksichtnahmen. Diese ergeben sich zum Teil aus dem Gesetz: Zum Beispiel dürfen Richter*innen keine Vorstandsfunktionen in Kapitalgesellschaften annehmen, müssen eine ethische Herangehensweise bei öffentlichen Auftritten an den Tag legen und auch eine gewisse Distanz zu politischen Parteien haben. Wichtig ist eine saubere Trennung [von beruflicher Tätigkeit und privatem Engagement] und Professionalität im Beruf. Grundsätzlich würde ich jedoch aus meiner Biographie heraus sagen, dass der Beruf des Richters/der Richterin ein zivilgesellschaftliches Engagement nicht ausschließen darf und im Sinne der freien Meinungsäußerung auch nicht ausschließen kann.
Klemen: Die derzeitige Lage der Justiz liefert ausreichend
Anlässe für ein solches Engagement. Man hört ständig, es seien zu wenig
finanzielle Mittel vorhanden, bei der Staatsanwaltschaft fehle es an Personal.
Trotzdem wird Budget gekürzt und Planstellen werden nicht nachbesetzt. Das
zeigt sich auch in komplizierten Korruptions- und Wirtschaftsstrafverfahren,
wie zuletzt bei der Eurofighter-Causa. Wie nehmen Sie das in der Praxis wahr?
Anlässe für ein solches Engagement. Man hört ständig, es seien zu wenig
finanzielle Mittel vorhanden, bei der Staatsanwaltschaft fehle es an Personal.
Trotzdem wird Budget gekürzt und Planstellen werden nicht nachbesetzt. Das
zeigt sich auch in komplizierten Korruptions- und Wirtschaftsstrafverfahren,
wie zuletzt bei der Eurofighter-Causa. Wie nehmen Sie das in der Praxis wahr?
Scheiber: Die aktuellen
Schwierigkeiten haben eine lange Vorgeschichte. Die Justiz ist traditionell ein
sehr sparsames Ressort mit wenigen Ermessensausgaben. Als dann die
gleichmäßigen Kürzungen in allen Ressorts vor etwa 20, 30 Jahren begonnen
haben, war die schon damals schlanke Justiz natürlich doppelt betroffen. In den
letzten Jahren haben wir jedoch gesehen, dass bei der Justiz gekürzt wird,
während z.B. bei der Polizei Aufstockungen erfolgen. Das hat definitiv zu einer
Schieflage geführt.
Schwierigkeiten haben eine lange Vorgeschichte. Die Justiz ist traditionell ein
sehr sparsames Ressort mit wenigen Ermessensausgaben. Als dann die
gleichmäßigen Kürzungen in allen Ressorts vor etwa 20, 30 Jahren begonnen
haben, war die schon damals schlanke Justiz natürlich doppelt betroffen. In den
letzten Jahren haben wir jedoch gesehen, dass bei der Justiz gekürzt wird,
während z.B. bei der Polizei Aufstockungen erfolgen. Das hat definitiv zu einer
Schieflage geführt.
Parger: Könnte man das als einen Angriff auf den Rechtsstaat
interpretieren?
interpretieren?
Scheiber: Könnte man, wenn man
unterstellen mag, dass dahinter ein Plan oder eine Absicht steht. Es ist
natürlich bei jeder politischen Partei, die ein (eher) autoritäres Staatsbild
vor sich hat, eine Tendenz da, die Polizei zu stärken und Ressourcen bei
kontrollierenden Einrichtungen wie Justiz oder Parlament zurückzunehmen.
unterstellen mag, dass dahinter ein Plan oder eine Absicht steht. Es ist
natürlich bei jeder politischen Partei, die ein (eher) autoritäres Staatsbild
vor sich hat, eine Tendenz da, die Polizei zu stärken und Ressourcen bei
kontrollierenden Einrichtungen wie Justiz oder Parlament zurückzunehmen.
Parger: Viele
Richter*innen fühlen sich im Stich gelassen und fürchten sogar, dass die
finanzielle Situation der Justiz den Rechtsstaat gefährde. Dazu kommen
wiederholte Angriffe der bis vor kurzem regierenden freiheitlichen Partei.
Herbert Kickl [ehemaliger Innenminister] hat etwa die europäische
Menschenrechtskonvention infrage gestellt und damit die Verfassung – die Grundlage
unseres Rechtsstaates. Sehen Sie das auch so drastisch wie Ihre
Richterkolleg*innen?
Richter*innen fühlen sich im Stich gelassen und fürchten sogar, dass die
finanzielle Situation der Justiz den Rechtsstaat gefährde. Dazu kommen
wiederholte Angriffe der bis vor kurzem regierenden freiheitlichen Partei.
Herbert Kickl [ehemaliger Innenminister] hat etwa die europäische
Menschenrechtskonvention infrage gestellt und damit die Verfassung – die Grundlage
unseres Rechtsstaates. Sehen Sie das auch so drastisch wie Ihre
Richterkolleg*innen?
Scheiber: Ich würde es schon so drastisch sehen, weil ich
glaube, es gibt bei diesen Entwicklungen hin zum Autoritären immer einen
Zeitpunkt, an dem das Ganze kippt und kaum mehr rückgängig zu machen ist. Ein
solch kritischer Moment war die BVT-Affäre, die Gott sei Dank viele
wachgerüttelt hat. Zum anderen sei erwähnt, dass es Tradition der FPÖ ist, sich
mit der Justiz schwer zu tun. Das war bei der ersten schwarz-blauen Koalition unter Schüssel ähnlich.
glaube, es gibt bei diesen Entwicklungen hin zum Autoritären immer einen
Zeitpunkt, an dem das Ganze kippt und kaum mehr rückgängig zu machen ist. Ein
solch kritischer Moment war die BVT-Affäre, die Gott sei Dank viele
wachgerüttelt hat. Zum anderen sei erwähnt, dass es Tradition der FPÖ ist, sich
mit der Justiz schwer zu tun. Das war bei der ersten schwarz-blauen Koalition unter Schüssel ähnlich.
Klemen: Auf der einen
Seite gibt es Kürzungen im Bereich der Justiz, auf der anderen Seite werden
etwa in Wirtschaftsstrafverfahren sowie auch im allgemeinen Strafrecht
scheinbar höhere Anforderungen an die Justiz gestellt. 2018 ist in Erinnerung
als Jahr mit verhältnismäßig vielen Morden an Frauen. Deren Zahl hat sich im
Vergleich zu 2014 mehr als verdoppelt. Sehen Sie Zusammenhänge zwischen dem
Ressourcen- und Personalmangel in der Justiz und dem Anstieg an Gewalttaten
gegen Frauen?
Seite gibt es Kürzungen im Bereich der Justiz, auf der anderen Seite werden
etwa in Wirtschaftsstrafverfahren sowie auch im allgemeinen Strafrecht
scheinbar höhere Anforderungen an die Justiz gestellt. 2018 ist in Erinnerung
als Jahr mit verhältnismäßig vielen Morden an Frauen. Deren Zahl hat sich im
Vergleich zu 2014 mehr als verdoppelt. Sehen Sie Zusammenhänge zwischen dem
Ressourcen- und Personalmangel in der Justiz und dem Anstieg an Gewalttaten
gegen Frauen?
Scheiber: Bei der Einschätzung wäre ich vorsichtig. Klar ist,
dass darüber Aufschlüsse, Forschungen sowie Studien fehlen. Es ist schon
denkbar, dass dies eine gewisse Häufung ist, die in dem einen Kalenderjahr
aufgetreten ist. Ich kann keinen direkten Konnex herstellen zwischen schlechter
Budgetsituation und dem raschen Anstieg der Kriminalität genau in diesem
Bereich. Im Jahr 2019 setzt sich das auch zum Glück bislang nicht so fort.
dass darüber Aufschlüsse, Forschungen sowie Studien fehlen. Es ist schon
denkbar, dass dies eine gewisse Häufung ist, die in dem einen Kalenderjahr
aufgetreten ist. Ich kann keinen direkten Konnex herstellen zwischen schlechter
Budgetsituation und dem raschen Anstieg der Kriminalität genau in diesem
Bereich. Im Jahr 2019 setzt sich das auch zum Glück bislang nicht so fort.
Klemen: Mangelnde
Ressourcen können auch die effiziente Abwicklung des Ermittlungsverfahrens
erschweren. Seitens der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser etwa wurde
kritisiert, dass dies zur Folge haben kann, dass Täter nicht in
Untersuchungshaft kommen und dass Opfer daher oftmals auch nach Erstattung der
Anzeige weiterhin in Gefahr sind.
Ressourcen können auch die effiziente Abwicklung des Ermittlungsverfahrens
erschweren. Seitens der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser etwa wurde
kritisiert, dass dies zur Folge haben kann, dass Täter nicht in
Untersuchungshaft kommen und dass Opfer daher oftmals auch nach Erstattung der
Anzeige weiterhin in Gefahr sind.
Scheiber: Bei vielen Beratungs- und Unterstützungsvereinen für
Opfer oder gefährdete Personen wurden die Mittel gekürzt. Dass das negative
Folgen hat, ist naheliegend. Dass sich das auch auswirkt auf ein längeres
Fortbestehen oder Nichtabbrechen von Gefahrensituationen, ist auch naheliegend.
Die Untersuchungshaftfrage sehe ich nicht unbedingt als den Knackpunkt.
Vielmehr glaube ich, dass wir ein Defizit bei Gefährlichkeitsprognosen und
Prognoseentscheidungen haben und dass dieser Mangel zu einem Anstieg der
Gewaltkriminalität führen kann. Außerdem besteht ein Kommunikationsproblem.
Polizei, Staatsanwaltschaft, Psychiatrien und Krankenhäuser kommunizieren zu
schwerfällig miteinander. So werden etwa wesentliche Informationen, teilweise
aus Datenschutzerwägungen, nicht gegenseitig ausgetauscht. Meines Erachtens ist
dies ein starkes Element dafür, dass Gefahrenlagen nicht rechtzeitig
abgebrochen werden.
Opfer oder gefährdete Personen wurden die Mittel gekürzt. Dass das negative
Folgen hat, ist naheliegend. Dass sich das auch auswirkt auf ein längeres
Fortbestehen oder Nichtabbrechen von Gefahrensituationen, ist auch naheliegend.
Die Untersuchungshaftfrage sehe ich nicht unbedingt als den Knackpunkt.
Vielmehr glaube ich, dass wir ein Defizit bei Gefährlichkeitsprognosen und
Prognoseentscheidungen haben und dass dieser Mangel zu einem Anstieg der
Gewaltkriminalität führen kann. Außerdem besteht ein Kommunikationsproblem.
Polizei, Staatsanwaltschaft, Psychiatrien und Krankenhäuser kommunizieren zu
schwerfällig miteinander. So werden etwa wesentliche Informationen, teilweise
aus Datenschutzerwägungen, nicht gegenseitig ausgetauscht. Meines Erachtens ist
dies ein starkes Element dafür, dass Gefahrenlagen nicht rechtzeitig
abgebrochen werden.
Parger: Sie sind auch
Vorstandsmitglied in der Opferschutzeinrichtung Weißer Ring. Inwiefern war
diese Organisation von Einsparungsmaßnahmen durch den Staat betroffen?
Vorstandsmitglied in der Opferschutzeinrichtung Weißer Ring. Inwiefern war
diese Organisation von Einsparungsmaßnahmen durch den Staat betroffen?
Scheiber: Es ist generell schwierig, öffentliche Gelder zu
lukrieren. Auch für die besten Zwecke ist es schwierig geworden. Im Bereich des
Opferschutzes gibt es die psychosoziale und die juristische Prozessbegleitung.
Wenn etwas passiert ist, dann hat das Opfer Anspruch auf staatliche Leistungen
sowie Opferschutzleistungen. Das hilft bei der Vermeidung der Gewalttaten aber
praktisch gar nicht. Gefahren zu erkennen und einzugreifen, bevor etwas
passiert, ist die größte Herausforderung.
lukrieren. Auch für die besten Zwecke ist es schwierig geworden. Im Bereich des
Opferschutzes gibt es die psychosoziale und die juristische Prozessbegleitung.
Wenn etwas passiert ist, dann hat das Opfer Anspruch auf staatliche Leistungen
sowie Opferschutzleistungen. Das hilft bei der Vermeidung der Gewalttaten aber
praktisch gar nicht. Gefahren zu erkennen und einzugreifen, bevor etwas
passiert, ist die größte Herausforderung.
Parger: Was wären
solche Institutionen, die die Gefahr erkennen könnten?
solche Institutionen, die die Gefahr erkennen könnten?
Scheiber: Das kann sowohl die Schule
selbst sein, der etwas auffällt, das kann aber auch ein Kind sein, das einem
Lehrer berichtet. Das kann natürlich
auch der praktische Arzt sein, der bei einer ständigen Patientin
Gewalteinwirkungen feststellt. Das kann eine Notaufnahme im Krankenhaus sein,
aber natürlich auch die Polizei selbst.
selbst sein, der etwas auffällt, das kann aber auch ein Kind sein, das einem
Lehrer berichtet. Das kann natürlich
auch der praktische Arzt sein, der bei einer ständigen Patientin
Gewalteinwirkungen feststellt. Das kann eine Notaufnahme im Krankenhaus sein,
aber natürlich auch die Polizei selbst.
Klemen: Wo könnte man
Ihres Erachtens nach ansetzen?
Ihres Erachtens nach ansetzen?
Scheiber: Wichtig ist die Information der Öffentlichkeit:
Sensibilisierung auf altersgerechte Art und Weise, auch bei Kindern,
Jugendlichen und der Lehrerschaft. Ein weiterer Punkt ist sicher die
Fortbildung, das heißt eine Sensibilisierung auch von Jurist*innen.
Sensibilisierung auf altersgerechte Art und Weise, auch bei Kindern,
Jugendlichen und der Lehrerschaft. Ein weiterer Punkt ist sicher die
Fortbildung, das heißt eine Sensibilisierung auch von Jurist*innen.
Klemen: Kommen wir zur geplanten
Strafrechtsreform – dem sogenannten dritten Gewaltschutzgesetz. Dieses umfasst
ein Bündel verschiedener Änderungen, die im Herbst beschlossen werden sollen.
Unter anderem werden zwei Ziele verfolgt: Es
soll im Bereich der Gewalt- und Sexualdelikte bei einigen Tatbeständen
zu einer Straferhöhung kommen. Außerdem sollen die Opferrechte in der
Strafprozessordnung eine umfassende Erweiterung erfahren. Insgesamt gehe es
darum – so die frühere Staatssekretärin Edtstadler – Tätern gegenüber „null
Toleranz“ zu zeigen. Was halten Sie von dieser Zielsetzung?
Strafrechtsreform – dem sogenannten dritten Gewaltschutzgesetz. Dieses umfasst
ein Bündel verschiedener Änderungen, die im Herbst beschlossen werden sollen.
Unter anderem werden zwei Ziele verfolgt: Es
soll im Bereich der Gewalt- und Sexualdelikte bei einigen Tatbeständen
zu einer Straferhöhung kommen. Außerdem sollen die Opferrechte in der
Strafprozessordnung eine umfassende Erweiterung erfahren. Insgesamt gehe es
darum – so die frühere Staatssekretärin Edtstadler – Tätern gegenüber „null
Toleranz“ zu zeigen. Was halten Sie von dieser Zielsetzung?
Scheiber: Ich halte diese
Null-Toleranz-Botschaften für leere Schlagworte und denke, sie sind auch
wissenschaftlich widerlegt. Wir haben die USA mit einem starken Strafanspruch,
sehr vielen Haftstrafen und gleichzeitig einer hohen Kriminalität. Es ist
hinlänglich ausdiskutiert, dass Straferhöhungen nicht zu einer Senkung der Kriminalität führen. Der
Gesetzesvorschlag enthält einige sinnvolle Maßnahmen im Bereich des
Opferschutzes. Wo er jedoch im StGB ansetzt, ist er eher schädlich, weil der
Ermessensspielraum der Richter*innen zu stark eingeschränkt werden soll.
Null-Toleranz-Botschaften für leere Schlagworte und denke, sie sind auch
wissenschaftlich widerlegt. Wir haben die USA mit einem starken Strafanspruch,
sehr vielen Haftstrafen und gleichzeitig einer hohen Kriminalität. Es ist
hinlänglich ausdiskutiert, dass Straferhöhungen nicht zu einer Senkung der Kriminalität führen. Der
Gesetzesvorschlag enthält einige sinnvolle Maßnahmen im Bereich des
Opferschutzes. Wo er jedoch im StGB ansetzt, ist er eher schädlich, weil der
Ermessensspielraum der Richter*innen zu stark eingeschränkt werden soll.
Klemen: § 201 StGB – das Verbrechen der Vergewaltigung: Hier
soll es zu einer Erhöhung der Mindeststrafe von einem auf zwei Jahre kommen.
Wie beurteilen Sie diese Verschärfung? Könnte sie sich auch gegenteilig, d.h.
nicht im Sinne des Reformzweckes auf Ihr richterliches Urteil auswirken?
soll es zu einer Erhöhung der Mindeststrafe von einem auf zwei Jahre kommen.
Wie beurteilen Sie diese Verschärfung? Könnte sie sich auch gegenteilig, d.h.
nicht im Sinne des Reformzweckes auf Ihr richterliches Urteil auswirken?
Scheiber: Starre Regelungen wie
Mindeststrafen haben vielerlei ungünstige und zum Teil verheerende Folgen. Sie
sind generell ein sehr untaugliches Instrument, wenn man von wenigen Fällen
absieht. Man muss immer vor Augen haben, dass sowohl die Straftaten in ihrer
Ausformung völlig unterschiedlich sind, als auch die Täterpersönlichkeiten.
Mindeststrafen haben vielerlei ungünstige und zum Teil verheerende Folgen. Sie
sind generell ein sehr untaugliches Instrument, wenn man von wenigen Fällen
absieht. Man muss immer vor Augen haben, dass sowohl die Straftaten in ihrer
Ausformung völlig unterschiedlich sind, als auch die Täterpersönlichkeiten.
Ein Strafrecht mit dem Ziel,
Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern, muss Richter*innen ein
möglichst flexibles Instrumentarium geben.
Das schafft man mit Mindeststrafen ab. Opferschutz muss immer auch die
Täter und die Auswirkungen der Strafe auf diese mitdenken. Es ist ein
schlechter Dienst an den Opfern, einfach blind auf den Täter hinzuhauen.
Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern, muss Richter*innen ein
möglichst flexibles Instrumentarium geben.
Das schafft man mit Mindeststrafen ab. Opferschutz muss immer auch die
Täter und die Auswirkungen der Strafe auf diese mitdenken. Es ist ein
schlechter Dienst an den Opfern, einfach blind auf den Täter hinzuhauen.
Parger: Das Strafrecht soll das Ziel verfolgen, eine
maßgeschneiderte Strafe für die Täter zu urteilen?
maßgeschneiderte Strafe für die Täter zu urteilen?
Scheiber: Genau! Das ist aus einem
humanistischen Zugang zum Strafrecht notwendig, aber auch ganz pragmatisch
wegen des Opferschutzes und des Schutzes der Gesellschaft. Die Fragen sollten
sein: Wie gelingt es, dass es möglichst wenige Straftaten gibt? Wie erreiche
ich eine geringe Rückfallquote? Dafür muss das Strafrecht flexibel sein, denn
einmal ist eine Haftstrafe angemessen, ein anderes Mal eine Therapie oder eine
Kombination aus beidem.
humanistischen Zugang zum Strafrecht notwendig, aber auch ganz pragmatisch
wegen des Opferschutzes und des Schutzes der Gesellschaft. Die Fragen sollten
sein: Wie gelingt es, dass es möglichst wenige Straftaten gibt? Wie erreiche
ich eine geringe Rückfallquote? Dafür muss das Strafrecht flexibel sein, denn
einmal ist eine Haftstrafe angemessen, ein anderes Mal eine Therapie oder eine
Kombination aus beidem.
Parger: Bei sexueller und familiärer Gewalt sind es
überwiegend Männer, die Frauen und Kindern Gewalt zufügen. Wie ist Ihre
Erfahrung mit dem Erfolg von Burschen- bzw. Männerarbeit? Wie sehr wird in der
Praxis ein Fokus darauf gesetzt, Anti-Gewalt-Training in einer Weisung zu
erteilen oder Burschen möglichst jung zu sensibilisieren?
überwiegend Männer, die Frauen und Kindern Gewalt zufügen. Wie ist Ihre
Erfahrung mit dem Erfolg von Burschen- bzw. Männerarbeit? Wie sehr wird in der
Praxis ein Fokus darauf gesetzt, Anti-Gewalt-Training in einer Weisung zu
erteilen oder Burschen möglichst jung zu sensibilisieren?
Scheiber: Ich glaube, wir haben
immer noch zu wenig Angebote für männliche Gewalttäter. Es wird oft als
Schwäche ausgelegt, wenn sich Burschen oder Männer Therapien unterziehen. Das
Gewaltschutzgesetz vor 20 Jahren hat schon die Möglichkeit eröffnet, Männer bei
familiärer Gewalt aus der Wohnung zu weisen. Obwohl diese Regelung sehr
fortschrittlich war, hat man den Fehler gemacht, sich in Folge zu wenig um
diese weggewiesenen Männer zu kümmern. Das fällt letztlich allen Beteiligten
auf den Kopf.
immer noch zu wenig Angebote für männliche Gewalttäter. Es wird oft als
Schwäche ausgelegt, wenn sich Burschen oder Männer Therapien unterziehen. Das
Gewaltschutzgesetz vor 20 Jahren hat schon die Möglichkeit eröffnet, Männer bei
familiärer Gewalt aus der Wohnung zu weisen. Obwohl diese Regelung sehr
fortschrittlich war, hat man den Fehler gemacht, sich in Folge zu wenig um
diese weggewiesenen Männer zu kümmern. Das fällt letztlich allen Beteiligten
auf den Kopf.
Klemen: Wie entscheiden Sie in der Praxis? Welche Kriterien
werden bei der Beurteilung herangezogen, ob ein Täter während seiner Haftstrafe
Therapie machen muss oder nicht?
werden bei der Beurteilung herangezogen, ob ein Täter während seiner Haftstrafe
Therapie machen muss oder nicht?
Scheiber: Hier muss unterschieden
werden. Wir haben einerseits den großen Bereich des Maßnahmenvollzuges:
psychisch kranke Täter, die nicht im normalen Strafvollzug unterkommen. Daneben
gibt es den normalen Strafvollzug mit verschiedenen Varianten. Wird eine Person
zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt, entscheidet das Gericht darüber, ob
Auflagen dazukommen, das heißt ob Weisungen erteilt werden. Das kann eine
Drogenentzugsbehandlung oder auch eine Anti-Aggressionstherapie sein. Spricht
das Gericht jedoch eine unbedingte Strafe aus [das bedeutet, dass der Täter in
Strafhaft kommt], dann obliegt diese Entscheidung dem Strafvollzug selbst, d.h.
der Gefängnisverwaltung und den Strafvollzugsinstanzen.
werden. Wir haben einerseits den großen Bereich des Maßnahmenvollzuges:
psychisch kranke Täter, die nicht im normalen Strafvollzug unterkommen. Daneben
gibt es den normalen Strafvollzug mit verschiedenen Varianten. Wird eine Person
zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt, entscheidet das Gericht darüber, ob
Auflagen dazukommen, das heißt ob Weisungen erteilt werden. Das kann eine
Drogenentzugsbehandlung oder auch eine Anti-Aggressionstherapie sein. Spricht
das Gericht jedoch eine unbedingte Strafe aus [das bedeutet, dass der Täter in
Strafhaft kommt], dann obliegt diese Entscheidung dem Strafvollzug selbst, d.h.
der Gefängnisverwaltung und den Strafvollzugsinstanzen.
Klemen: Die Reform umfasst auch Änderungen im
Jugendstrafrecht. So soll der Strafrahmen von jungen Erwachsenen mit jenem von
Erwachsenen gleichgesetzt werden. Außerdem soll die Möglichkeit lebenslanger
Haftstrafen geschaffen werden. Unter 20-Jährigen lebenslange Haftstrafen zu
geben war zuletzt Anfang des 19. Jahrhunderts möglich. Halten Sie diese
Änderung für einen Rückschritt?
Jugendstrafrecht. So soll der Strafrahmen von jungen Erwachsenen mit jenem von
Erwachsenen gleichgesetzt werden. Außerdem soll die Möglichkeit lebenslanger
Haftstrafen geschaffen werden. Unter 20-Jährigen lebenslange Haftstrafen zu
geben war zuletzt Anfang des 19. Jahrhunderts möglich. Halten Sie diese
Änderung für einen Rückschritt?
Scheiber: Es ist einfach die
Rückkehr des plumpen Vergeltungsgedankens. Dabei handelt es sich mit Abstand um
den schlimmsten Punkt in diesem Gesetzesvorschlag. Ich hoffe immer noch, dass
es nicht umgesetzt wird. Ich halte die Idee für bösartig und wider jeden Trend.
Eine Art Gegenaufklärung kann man sagen.
Rückkehr des plumpen Vergeltungsgedankens. Dabei handelt es sich mit Abstand um
den schlimmsten Punkt in diesem Gesetzesvorschlag. Ich hoffe immer noch, dass
es nicht umgesetzt wird. Ich halte die Idee für bösartig und wider jeden Trend.
Eine Art Gegenaufklärung kann man sagen.
Parger: Sprechen wir über Ihr Buch Sozialdemokratie – letzter Aufruf. Dort schreiben Sie gleich zu
Beginn: „Wer wo im Gerichtssaal sitzt, ob jemand sich bei den Angeklagten, bei
den RichterInnen, bei den AnwältInnen oder SchuldnerInnen wiederfindet. Das
hängt stark von jenem Zufall ab, in welche soziale Umgebung, in welche Familie
er oder sie geboren wurde.“ Im Strafgericht wird auf Basis der individuellen
Schuld geurteilt. Es wird wenig über das familiäre Umfeld und über die soziale
Herkunft gesprochen. Wie könnte man mehr darauf eingehen?
Beginn: „Wer wo im Gerichtssaal sitzt, ob jemand sich bei den Angeklagten, bei
den RichterInnen, bei den AnwältInnen oder SchuldnerInnen wiederfindet. Das
hängt stark von jenem Zufall ab, in welche soziale Umgebung, in welche Familie
er oder sie geboren wurde.“ Im Strafgericht wird auf Basis der individuellen
Schuld geurteilt. Es wird wenig über das familiäre Umfeld und über die soziale
Herkunft gesprochen. Wie könnte man mehr darauf eingehen?
Scheiber: Sieht man sich das österreichische
StGB an, so würde ich meinen, dass die Praxis dem Gesetz hinterherhinkt. Unser
Gesetz stammt aus den 1970er Jahren, einer stark aufklärerischen, progressiven
Phase der Justizgesetzgebung. Das Gesetz hat seit damals einen breiten
Horizont, ist menschenfreundlich und denkt unter Berücksichtigung der sozialen
Hintergründe. Das sieht man an einigen Formulierungen. Wenn man die Milderungs-
und Erschwerungsgründe betrachtet, ist erkennbar, dass die Milderungsgründe
deutlich überwiegen. Das Gesetz denkt schon weit in die Täterbiographien
hinein. Die praktische Umsetzung dessen ist eher unbefriedigend. Wir
beschäftigen uns in Österreich ausführlich mit der Tat, jedoch recht wenig mit
der Persönlichkeit des Täters. Das ist bereits bei einem Blick auf den
Akteninhalt erkenntlich. Rund 95% des Papieraktes drehen sich um die Tat und
ihre Modalitäten. In anderen Ländern, etwa in der Schweiz, ist dies anders.
Dort beschäftigt sich etwa ein Drittel des Aktes mit der Person. Auch Verfahren
werden anders geführt. So teilt man in anderen Ländern die Verhandlung in
verschiedene Abschnitte: Zunächst wird überprüft, ob es zu einem Freispruch
oder Schuldspruch kommt. Im Falle eines Schuldspruchs käme dann ein zweiter
Teil der Verhandlung, der sich mit der Person des Täters und der Frage nach
einer geeigneten Sanktion beschäftigt.
StGB an, so würde ich meinen, dass die Praxis dem Gesetz hinterherhinkt. Unser
Gesetz stammt aus den 1970er Jahren, einer stark aufklärerischen, progressiven
Phase der Justizgesetzgebung. Das Gesetz hat seit damals einen breiten
Horizont, ist menschenfreundlich und denkt unter Berücksichtigung der sozialen
Hintergründe. Das sieht man an einigen Formulierungen. Wenn man die Milderungs-
und Erschwerungsgründe betrachtet, ist erkennbar, dass die Milderungsgründe
deutlich überwiegen. Das Gesetz denkt schon weit in die Täterbiographien
hinein. Die praktische Umsetzung dessen ist eher unbefriedigend. Wir
beschäftigen uns in Österreich ausführlich mit der Tat, jedoch recht wenig mit
der Persönlichkeit des Täters. Das ist bereits bei einem Blick auf den
Akteninhalt erkenntlich. Rund 95% des Papieraktes drehen sich um die Tat und
ihre Modalitäten. In anderen Ländern, etwa in der Schweiz, ist dies anders.
Dort beschäftigt sich etwa ein Drittel des Aktes mit der Person. Auch Verfahren
werden anders geführt. So teilt man in anderen Ländern die Verhandlung in
verschiedene Abschnitte: Zunächst wird überprüft, ob es zu einem Freispruch
oder Schuldspruch kommt. Im Falle eines Schuldspruchs käme dann ein zweiter
Teil der Verhandlung, der sich mit der Person des Täters und der Frage nach
einer geeigneten Sanktion beschäftigt.
Klemen: Woran liegt es, dass es im Bereich der sexuellen
Gewalt zwar viele Anzeigen gibt, es aber im Verhältnis dazu zu wenigen
Verurteilungen kommt? Weil die Staatsanwaltschaft erst gar nicht Anklage gegen
die Verdächtigten erhebt, sondern das
Verfahren einstellt?
Gewalt zwar viele Anzeigen gibt, es aber im Verhältnis dazu zu wenigen
Verurteilungen kommt? Weil die Staatsanwaltschaft erst gar nicht Anklage gegen
die Verdächtigten erhebt, sondern das
Verfahren einstellt?
Scheiber: Ich glaube der Knackpunkt
bei Sexualdelikten und bei dieser Form der familiären Gewaltdelikte ist, dass
es sich um eine besondere Form der Kriminalität handelt. Sie passiert meistens
ohne Zeug*innen. Das führt oft dazu, dass sich im Ermittlungsverfahren zwei
Aussagen gegenüberstehen. Daher ist die Geschwindigkeit bei solchen Delikten
von besonderer Bedeutung. Alles, was an Beweisen sehr schnell gesichert wird,
erleichtert eine Anklageerhebung. Je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger wird
das. Aus diesem Grund würde ich den Schwerpunkt bei der Unterstützung der Opfer
setzen. Bereits einfache Handlungen, etwa das Fotografieren der Verletzungen,
können im Verfahren einen wesentlichen Unterschied machen. Darüber müssen Opfer
aufgeklärt werden. Wird das vergessen und kann man die Verletzung eine Woche
später nicht mehr erkennen, ist die Beweislage aus strafrechtlicher Sicht
bereits ganz anders.
bei Sexualdelikten und bei dieser Form der familiären Gewaltdelikte ist, dass
es sich um eine besondere Form der Kriminalität handelt. Sie passiert meistens
ohne Zeug*innen. Das führt oft dazu, dass sich im Ermittlungsverfahren zwei
Aussagen gegenüberstehen. Daher ist die Geschwindigkeit bei solchen Delikten
von besonderer Bedeutung. Alles, was an Beweisen sehr schnell gesichert wird,
erleichtert eine Anklageerhebung. Je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger wird
das. Aus diesem Grund würde ich den Schwerpunkt bei der Unterstützung der Opfer
setzen. Bereits einfache Handlungen, etwa das Fotografieren der Verletzungen,
können im Verfahren einen wesentlichen Unterschied machen. Darüber müssen Opfer
aufgeklärt werden. Wird das vergessen und kann man die Verletzung eine Woche
später nicht mehr erkennen, ist die Beweislage aus strafrechtlicher Sicht
bereits ganz anders.
Klemen: Sie haben bereits angesprochen, dass hier auch die
Umgebung, etwa Freunde, Bekannte und Nachbarn aufmerksam sein sollen.
Umgebung, etwa Freunde, Bekannte und Nachbarn aufmerksam sein sollen.
Scheiber: Genau und ich glaube, dass
man auch gesetzlich etwas tun sollte, um klarzustellen, dass es jedenfalls
nicht gesetzwidrig sein kann, wenn Institutionen wie die Schule oder der
Kindergarten Verdachtsmomente mitteilen und Informationen weitergeben. Wir
merken oft eine Hemmung seitens der Lehrerschaft. Oft werden Informationen
nicht weitergegeben, aufgrund des „Datenschutzes“. Klar ist: Überall dort, wo auch
nur der Verdacht besteht, dass Menschen gefährdet sind, sollten diese
Überlegungen keine Rolle spielen dürfen.
man auch gesetzlich etwas tun sollte, um klarzustellen, dass es jedenfalls
nicht gesetzwidrig sein kann, wenn Institutionen wie die Schule oder der
Kindergarten Verdachtsmomente mitteilen und Informationen weitergeben. Wir
merken oft eine Hemmung seitens der Lehrerschaft. Oft werden Informationen
nicht weitergegeben, aufgrund des „Datenschutzes“. Klar ist: Überall dort, wo auch
nur der Verdacht besteht, dass Menschen gefährdet sind, sollten diese
Überlegungen keine Rolle spielen dürfen.
Klemen: Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Haben Sie
als Abschluss noch eine Botschaft, die Sie unseren Leser*innen mitgeben möchten?
als Abschluss noch eine Botschaft, die Sie unseren Leser*innen mitgeben möchten?
Egal, in welcher Rolle jemand vor Gericht auftritt: Jeder hat ein Recht darauf, dass ihm die staatlichen Behörden zuhören! Es ist ausgesprochen wichtig, Menschen ernst zu nehmen und die Vielschichtigkeit von Situationen mitzudenken. Es lohnt sich stets, Menschen zumindest fünf ehrliche Minuten zu schenken, denn wenn man ihnen Raum gibt, haben sie auch etwas zu sagen.
Wer mehr über Oliver Scheiber erfahren will, kann ihm auf seinem Blog oliverscheiber.blogspot.com sowie auf Twitter folgen.
Information für Betroffene und Unterstützer*innen:
Gewaltinfo: https://www.gewaltinfo.at/
Frauenhelpline: 0800/222 555
(anonym, kostenlos, Onlineberatung)
(anonym, kostenlos, Onlineberatung)
Männerberatung: https://www.maenner.at
Gewaltfreie Nachbarschaften aufbauen: https://stop-partnergewalt.at





