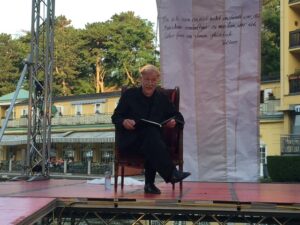Beitrag zu:
Kier/Schumann/Pollak/Marsch (Hrsg): Festschrift für Richard Soyer, Verlag Österreich (2025)
Übersicht
- Einführung
- Strafrecht und Rollenbild
- Jüngere Entwicklung des Strafrechts
- Europäisierung
- Rollenbilder im Ermittlungsverfahren
III. Rollenbilder im Haupt- und Rechtsmittelverfahren
- Rollenbilder im Strafvollzug
- Ausblick
I. Einführung
Dieser Beitrag befasst sich mit den Rollenbildern im Strafverfahren und legt dabei, der beruflichen Biografie des Jubilars Rechnung tragend, den Schwerpunkt auf das Rollenbild der Verteidigung in den verschiedenen Stadien eines Strafverfahrens. Dabei sollen Entwicklungen des Strafrechts der letzten Jahrzehnte aus richterlicher Sicht betrachtet werden. Die Einführung enthält einige Grundgedanken zum Strafverfahren, soweit sie für eine Diskussion des Rollenbildes wichtig erscheinen und widmet sich europarechtlichen Aspekten, die mittlerweile auch für das Strafrecht eine bestimmende Rolle übernommen haben.
A. Strafrecht und Rollenbild
Das Strafrecht greift regelmäßig stark in Grundrechte ein. Das gilt nicht nur für die Sanktion der Freiheitsstrafe oder für die Untersuchungshaft, sondern auch für die Vornahme von Hausdurchsuchungen oder die Sicherstellung von Mobiltelefonen.[1] Alle diese Eingriffe können, wenn man an die medialen Veröffentlichungen der letzten Jahre denkt,[2] schwerwiegende Folgen für Berufs- und Privatleben der betroffenen Verdächtigen, aber auch unbeteiligter Dritter, haben.[3] Sowohl für die Legistik als auch die Strafrechtspraxis kommt daher dem in Österreich in Verfassungsrang stehenden[4] obersten Rechtssatz der Europäischen Union, Art. I Grundrechtecharta, besondere Bedeutung zu: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.“[5] Damit ist auch schon eine wichtige Rolle der Verteidigung im Strafverfahren umrissen: in ganz besonderer Weise kommt der Verteidigung die Aufgabe zu, die Würde der Mandantinnen und Mandanten zu schützen und zu wahren.
Sowohl für die Gesetzgebung als auch die Strafrechtspraxis bildet das Ultima-ratio-Prinzip eine weitere zentrale Vorgabe: dem Strafrecht sollen nur schwerste Verletzungen der Ordnung des menschlichen Zusammenlebens vorbehalten sein.[6] Aus dem ebenfalls wesentlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip ergibt sich die Verpflichtung der Justiz, die Sanktionenpalette mit Bedacht einzusetzen, Grundrechtseingriffe nur zuzulassen, wo sie unbedingt notwendig sind und die Anwendung der Haft auf die schwersten Verdachts- und Deliktsfälle zu beschränken.[7]
B. Jüngere Entwicklung des Strafrechts
Der Strafprozess gehört zu den ältesten Institutionen des Rechtslebens und blieb in der Geschichte oft über viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte weitgehend unverändert. In Österreich kam es in den 1970er-Jahren zu großen, bis heute relevanten Strafrechtsreformen, die eine Humanisierung des Strafrechts und Strafvollzugs mit sich brachten.[8] Nach diesem Reformschub erlebte das Strafrecht wohl drei weitere große Neuerungsschübe. Der erste bestand in der Europäisierung des Strafrechts, auf die noch einzugehen ist. Der zweite große Reformschub war die allgemeine Einführung der Diversion im Jahr 2000, die die Reaktionspalette des Strafrechts enorm erweiterte.[9] Damit erhielten nicht nur Staatsanwält:innen und Richter:innen ganz neue Möglichkeiten, auch der Strafverteidigung öffneten sich neue Chancen und die Rolle der Verteidigung wurde mit deutlich mehr Verantwortung erfüllt. Die Verteidigung steht nun vor der Herausforderung, eine wichtige Rolle in einem restorativen Strafrechtssystem zu spielen. Jedenfalls hat die Diversion eine gesellschaftlich wichtige Entkriminalisierung vieler Handlungsweisen mit sich gebracht. Verändert hat sich dadurch nicht nur die Rolle der Verteidigung, sondern auch jene der Opfervertretung. Auch sie erhält die Möglichkeit, über die reine Klärung des Sachverhalts und die Sanktionierung des Täters hinaus sowohl für Opfer als auch für die Täter:innen nachhaltig Positives zu bewirken. Mit dem 2025 gestarteten Pilotprojekt[10] für einen Täter-Opfer-Ausgleich, der auch in Fällen angewendet werden kann, in denen die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Diversionsverfahren nicht vorliegen, wird das restorative System weiter ausgebaut und damit auch die Verantwortung der Rechtsanwält:innen weiter erhöht. Der dritte große Reformschub der jüngsten Zeit war der Umstieg vom Vorverfahren des Untersuchungsrichtermodells auf das neue Ermittlungsverfahren; darauf wird noch ausführlich eingegangen.
Im Zusammenhang mit dem Rollenbild der Verteidigung ist für Österreich zu beachten, dass eine Pflicht zur Verteidigung beziehungsweise ein Recht auf Verteidigung nur für die schwereren Delikte bzw bei bestimmten definierten, besonders grundrechtsrelevante Verfahrensstadien, etwa während der Untersuchungshaft, besteht.[11] Bei den allermeisten Bezirksgerichtsverfahren und auch bei vielen Einzelrichterverfahren an den Landesgerichten sind die Angeklagten weder im Ermittlungsverfahren noch in der Hauptverhandlung anwaltlich vertreten. Die mangelnde Vertretung soll durch die richterliche Anleitungs- und Informationspflicht ausgeglichen werden. Nach einem modernen Verständnis des fairen Verfahrens ist dies problematisch. Die Entwicklung geht wohl – maßgeblich angetrieben von unionsrechtlichen Vorgaben[12] – in Richtung einer Ausweitung der Vertretungspflicht bzw eines Rechts auf anwaltliche Vertretung. Für die vulnerable Gruppe der jugendlichen Verdächtigen hat die Europäische Union bereits eine absolute Anwaltspflicht ab der ersten polizeilichen Vernehmung geschaffen. [13]
C. Europäisierung
Das Strafrecht gehört wohl eher zu den strukturkonservativen Rechtsgebieten. Sowohl das Wirtschaftsrecht als auch Familien- und Zivilrecht entwickeln sich in vielen Bereichen dynamischer und passen sich schneller an gesellschaftliche Entwicklungen an. Das hängt einerseits damit zusammen, dass das Strafrecht in den meisten Staaten im Fokus der Öffentlichkeit steht. Das Bild der Justiz ist in der Regel sehr stark vom Strafrecht geprägt, obwohl sich die Justiz von der Zahl der Fälle und von den Ressourcen her betrachtet in weitaus größerem Maß mit anderen Feldern befasst. Die Strafjustiz ist aber für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wichtig und findet seit langem großes mediales Interesse, sei es im Bereich der Tötungsdelikte oder bei den großen Wirtschafts- und Korruptionsverfahren.
Nun besteht aber in der Strafrechtspraxis eine verbreitete Skepsis gegenüber internationalen oder europäischen Vorgaben.[14] Deshalb kam es auch so spät zur Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs. Auch der Harmonisierung durch die Europäische Union unterliegt das Strafrecht erst seit vergleichsweise kurzer Zeit. Die Arbeits- und Zuständigkeitsschwerpunkte der Union lagen zunächst bei der Umsetzung des Binnenmarkts und bei der Herstellung eines freien Wettbewerbs. Zu diesen Zwecken war es folgerichtig, dass Harmonisierungen zunächst auf dem Gebiet des Zivil- und Unternehmensrechts erfolgten. Erst mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere am 15. und 16. Oktober 1999 wurde die Grundlage für Harmonisierung des Strafrechts gelegt.[15] Am Beginn dieses Prozesses standen zunächst Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung strafgerichtlicher Entscheidungen.[16] Ein ganz großer Entwicklungsschritt war die Schaffung des Europäischen Haftbefehls.[17]
Als erster strafrechtlicher Gesetzgebungsakt im engeren Sinn gilt vielfach die Richtlinie zum Dolmetschen im Strafverfahren,[18] die auch gleich die Stärken der europäischen Gesetzgebung zeigte, mit den umfassenden Vorarbeiten, Beteiligungsmöglichkeiten und der frühzeitigen Beiziehung von Expert:innen aus den betroffenen Fachkreisen. Mit den Opferschutzrechtsakten[19] harmonisierte die Europäische Union die zentralen Rechte der Opfer eines Strafverfahrens, es folgte eine ganze Serie von Gesetzesakten, die sich mit den Beschuldigtenrechten befassen und damit auch für die Verteidigung und deren Rollenverständnis wichtig sind.[20] In jüngerer Zeit wurde hier etwa eine Vertretungspflicht für jugendliche Verdächtige eingeführt.[21] Zuletzt wurde die Union mit einer EU-Richtlinie über Umweltstraftaten[22] und einer Richtlinie, die sich mit der Gewalt gegen Frauen beschäftigt, im Strafrecht aktiv.[23] Die Aufnahme des Strafrechts in die Zuständigkeiten der Europäischen Union brachte die Zuständigkeit des EuGH für diverse Strafrechtsfragen mit sich. Auch können heute Strafrechtsfragen im Vorabentscheidungsverfahren geklärt werden. Die Rolle der strafrechtlichen Verteidigung ist damit wesentlich breiter und auch herausfordernder geworden.
Spät aber doch entstehen auch im Strafbereich europäische Einrichtungen. Die Schaffung von Eurojust[24] war ein erster Schritt, die strafrechtliche Zusammenarbeit in Europa unter den Justizbehörden der Mitgliedstaaten zu verbessern. Die Europäische Staatsanwaltschaft[25] ist nun eine genuin unionseigene operative Einrichtung, die sich in den ersten Jahren ihres Bestehens bewährt hat und in Zukunft wohl mit weiteren Zuständigkeiten ausgestattet werden wird.[26] Denn die grenzüberschreitenden Sachverhalte nehmen rasch zu, wodurch auch für die Rechtsanwält:innen das Tätigwerden über die Grenzen hinweg alltäglich geworden ist.
Neben der EU leistet auch der Europarat für das Strafrecht wichtige Arbeiten, einerseits mit der Ausarbeitung von Konventionen, andererseits mit Fortbildungsaktivitäten, die sich an alle juristischen Berufsgruppen richten und diese zusammenführen. Das HELP-Grundrechtsschulungsprogramm des Europarats bietet die derzeit besten Onlinetrainingstools,[27] die über Europa hinauswirken.
II. Rollenbilder im Ermittlungsverfahren
Mit 1. Jänner 2008 ist in Österreich die Reform des strafrechtlichen Vorverfahrens in Kraft getreten.[28] Man kann dabei durchaus von einer Jahrhundertreform sprechen, der allgemein die Funktion einer Verrechtlichung des Vorverfahrens, dass nun als Ermittlungsverfahren bezeichnet wird, zukommt. Mit dieser Reform wurden eine Vielzahl von Rechten des Verdächtigen bzw Beschuldigten ausdrücklich normiert und das Rechtsmittelsystem im Vorverfahren ausgebaut.[29] Waren früher die Untersuchungsrichter:innen die bestimmenden Personen im Vorverfahren, so wurde das Gericht im Ermittlungsverfahren zur Entscheidungs- und Kontrollinstanz umgestaltet und der Staatsanwaltschaft die Leitungsfunktion im Ermittlungsverfahrens zugewiesen. Mit der Reform wurde zugleich das Inquisitionsprinzip, das in der Person des Untersuchungsrichters oder der Untersuchungsrichterin stark ausgebildet war – sie konnten etwa die Untersuchungshaft ohne entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft verhängen – zurückgenommen.[30] Wenngleich die Staatsanwaltschaft weiterhin zur Objektivität und zur Sammlung entlastender wie belastender Beweise verpflichtet ist, so rückt das Ermittlungsverfahren in der Praxis nun doch näher an das Zweiparteiensystem des Zivilverfahrens. In der Wahrnehmung von Öffentlichkeit wie Fachkreisen stehen einander im Ermittlungsverfahren nun die Staatsanwaltschaft auf der einen Seite, Verdächtiger und Verteidigung auf der anderen Seite gegenüber. Damit hat aber auch die Rolle der Verteidigung mit der Strafprozessreform an Bedeutung gewonnen; und die Frage, ob ein Verdächtiger anwaltlich vertreten ist oder nicht, kommt bereits im Ermittlungsverfahren erhebliches Gewicht zu.[31]
Sowohl die Vorbereitung dieser großen Reform des Vorverfahrens als auch die Umsetzung haben insgesamt zu einem Qualitätsschub im Strafverfahren und einem stärkeren Dialog zwischen Wissenschaft, Gerichten, Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft über die Rollenverteilung und die Verfahrensausgestaltung geführt. Die intensive Diskussion manifestiert sich etwa im langjährigen Austausch über die Funktion der Privatsachverständigen.[32]
Die Rolle der Verteidigung im Vorverfahren wurde durch die Verrechtlichung im Rahmen der 2008 in Kraft getreten Reform massiv gestärkt. Dies schlägt sich auch in der starken Präsenz der Verteidiger:innen bereits im Ermittlungsverfahren und der medialen Berichterstattung nieder. Etwa zeitgleich mit Inkrafttreten des neuen Ermittlungsverfahrens gewann die Litigation PR auch in Österreich Bedeutung. Mit dieser und anderen Formen der die Verteidigung begleitenden Öffentlichkeitsarbeit änderte sich auch die Rolle der Strafverteidigung massiv.[33]
III. Rollenbilder im Haupt- und Rechtsmittelverfahren
Bei Inkrafttreten der Reform des Vorverfahrens im Jahr 2008 gingen die Fachkreise davon aus, dass die schon ebenfalls lang angedachte Reform des strafrechtlichen Haupt- und Rechtsmittelverfahrens bald folgen würde.[34] Alle diesbezüglichen Ambitionen sind jedoch aus vielfältigen Gründen – häufiger Wechsel in der Ressortleitung des Justizministeriums, politische Diskussionen über große Korruptionsverfahren, Probleme bei der Umsetzung der Vorverfahrensreform – eingeschlafen. Dabei wäre eine Reform des Haupt- und Rechtsmittelverfahrens im Strafverfahren dringlich.[35]
Im Hauptverfahren ist, in der Hauptverhandlung besonders gut sichtbar, das unzeitgemäße Inquisitionsprinzip durch die starke Rolle der Richter:innen immer noch ausgeprägt.[36] Das zeigt sich einerseits dort, wo Angeklagte nicht anwaltlich vertreten sind und die Richter:innen nicht selten den Angeklagten über den Strafantrag aufklären, den Gang des Verfahrens vorantreiben und gleichzeitig den Angeklagten über seine rechtlichen Möglichkeiten informieren und belehren sollen.[37] Auch bei bestem Bemühen der Richter:innen entsteht hier eine Schieflage zwischen der öffentlichen Anklage und dem unvertretenen Angeklagten.
Die alles überlagernde Rolle der Hauptverhandlungsrichter:innen lässt sich aber selbst dann hinterfragen, wenn Angeklagte anwaltlich vertreten sind. So entspräche es wohl einem modernen Verfahrensverständnis besser, wenn etwa das Fragerecht zunächst von den Parteien ausgeübt wird, beginnend mit jener Seite, die einen Zeugen oder eine Zeugen bzw eine:n Sachverständigen beantragt hat.[38] Je nachdem wer den Antrag gestellt hat, Staatsanwaltschaft oder Verteidigung, könnte das Fragerecht zuerst ausüben; das Gericht würde dann nur abschließende Fragen stellen. Von der Rollenverteilung abgesehen ist am aktuellen Hauptverfahren dringend reformbedürftig, dass sich die österreichische Strafrechtspraxis unverhältnismäßig ausgiebig mit der Tat bzw unangemessen wenig mit der Person des Angeklagten auseinandersetzt. Je weniger man sich mit der Person des Angeklagten beschäftigt, umso weniger treffsicher wird die Sanktion ausfallen, umso mehr unnötige Haftzeiten werden verhängt und umso unzureichender werden das Ultima-Ratio-Prinzip bei der Haft und die Verpflichtung zur Wahrung der Würde aller Beteiligten umgesetzt. Eine Zweiteilung der Hauptverhandlung nach dem Vorbild anderer Staaten, also zuerst ein Verhandlungsteil über die Schuldfrage und dann im Fall des Schuldspruchs ein ausführlicher zweiter Hauptverhandlungsteil, in dem die Sanktionenfrage erörtert wird, wäre ein Qualitätssprung im österreichischen Strafverfahren.[39] Die Zweiteilung der Hauptverhandlung würde auch die Rolle der Verteidigung stärken und ihr mehr Möglichkeiten geben, den Lebensweg der Mandantin und Mandanten dauerhaft positiv zu beeinflussen. Erste Erfahrungen mit Fallkonferenzen im Strafverfahren belegen die positiven Wirkungen einer Verbreiterung der Entscheidungsgrundlagen vor Beschlüssen der Strafgerichte.[40]
Das österreichische Rechtsmittelverfahren wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend formalisiert, nicht zuletzt durch die Auslegung der Strafprozessordnung durch die höchstgerichtliche Rechtsprechung.[41] Diese Formalisierung überfordert nicht nur viele, sie ist verfassungsrechtlich problematisch[42] und erschwert mittlerweile den Zugang zum Recht in unerträglicher Weise.[43] Grundsatz einer menschenfreundlichen Rechtspraxis muss es doch sein, bei jedem grobem Eingriff in das menschliche Leben den Zugang auch zu den Rechtsmittelgerichten möglichst formfrei zu gestalten. So ist das ja auch im Zivilrecht in familienrechtlichen Verfahren oder mietrechtlichen Verfahren umgesetzt. Dass im Strafverfahren, wo es um den Entzug der Freiheit geht, eine besondere Formalisierung vorherrscht, ist eines der großen Defizite der österreichischen Rechtspraxis.[44]
IV. Rollenbilder im Strafvollzug
Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren und das Haupt- und Rechtsmittelverfahren sind vergleichsweise eng miteinander verbunden. Staatsanwält:innen, die die Ermittlungen geführt haben, vertreten die Anklage zumindest in den wichtigen Verfahren auch in der Hauptverhandlung. Bei der Verteidigung besteht in der Regel personelle Kontinuität zwischen Ermittlungsverfahren und Haupt- und Rechtsmittelverfahren. Ganz anders ist es beim Strafvollzug. Für die Richter:innen der Hauptverhandlung endet die Befassung mit dem Angeklagten in der Regel mit dem Urteil. Die Zuständigkeiten für den zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Angeklagten wechseln dann im Wesentlichen zur Leitung der Justizanstalt bzw zu Richter:innensenaten, denen im Strafvollzug Aufgaben zu gewiesen sind. Ganz allgemein trifft man Richter:innen aber selten in Justizanstalten an. Die Systeme Gericht und Strafvollzug sind weitgehend voneinander abgekoppelt, was zu Informationsdefiziten und Kommunikationseinbußen führt. Die meisten im Straf- und Maßnahmenvollzug befindlichen Personen wiederum sind im gesamten Vollzugsverfahren anwaltlich nicht vertreten.[45] Dabei geht es bei Entscheidungen um die bedingte Entlassung oder um die Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug oft um viele Jahre in Freiheit oder in Haft. Es ist bedauerlich, dass die juristischen Berufe nicht gemeinsam auf eine anwaltliche Vertretungspflicht hinarbeiten, die der Bedeutung der Entscheidungen des Strafvollzugs angemessen wäre.[46]
Aktuell erübrigt sich die Befassung mit dem Rollenbild der anwaltlichen Vertretung im Strafvollzug schon deshalb, weil sie so selten vorkommt. Der Grund sind naturgemäß finanzielle Gründe. Es wäre Aufgabe des Staates, für eine anwaltliche Vertretung im Strafvollzug zu sorgen. Dies wäre auch systemkonform, da die Vertretungen in besonderem Ausmaß vulnerablen Personengruppen zukommen sollen. In Haft befindliche Menschen sind besonders vulnerabel. Es wäre nur folgerichtig, eine Vertretungspflicht für alle im Freiheitsentzug angehaltenen Personen vorzusehen; bei der Untersuchungshaft ist es ja bereits der Fall. [47]
V. Ausblick
Eine Modernisierung des österreichischen Strafrechts mit der Maßgabe, der Wahrung der Würde aller Menschen besser nachzukommen, müsste auf eine baldige Reform des Haupt- und Rechtsmittelverfahrens und eine Ausdehnung der anwaltlichen Vertretungspflicht hinauslaufen. Zur Finanzierung einer allgemeinen Vertretungspflicht in allen Stadien eines strafrechtlichen Verfahrens, insbesondere auch während der Anhaltung im Straf- und Maßnahmenvollzug, gäbe es verschiedene Modelle, von einer Ausdehnung der Verfahrenshilfe bis zu bei der Justiz angestellten Rechtsanwält:innen. Die allgemeine Vertretungspflicht – bzw ein Recht auf Vertretung – brächte eine Verbesserung des Strafrechtssystems mit sich und würde im Hinblick auf das Rollenbild helfen, das Zweiparteiensystem im Strafverfahren in allen Stadien, im Ermittlungsverfahren, im Haupt- und Rechtsmittelverfahren und im Strafvollzug, umzusetzen und eine Verrechtlichung mit gleichberechtigter öffentlicher Anklage und Verteidigung mit sich bringen.
Richard Soyer hat sich um die Entwicklung des österreichischen Strafrechtssystems in den letzten Jahrzehnten verdient gemacht wie nur wenige andere. Seine Wirkung verdankt sich einerseits seinem Engagement sowohl in der Strafrechtspraxis als auch in der Wissenschaft, andererseits seinem Einsatz zur Zusammenführung der Berufsgruppen. Die Gründung der Vereinigung der österreichischen Strafverteidiger:innen hat nicht nur das Tätigkeitsfeld der Strafverteidigung innerhalb der Anwaltschaft sichtbar gemacht und attraktiviert, sie hat vor allem auch den Austausch zwischen Richter:innen, Staatsanwält:innen und Strafverteidiger:innen auf eine ganz neue Ebene gehoben. Die hohe Zahl an Teilnehmer:innen beim jährlichen Strafverteidiger:innentag gibt davon Zeugnis. Aber auch die umfangreiche Publikationstätigkeit Richard Soyers, seine (Mit)Herausgeberschaften von juridikum und Journal für Strafrecht, können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit seiner ruhigen und umsichtigen Art der Strafverteidigung hat Richard Soyer auch das Bild der Strafverteidiger:innen in der Öffentlichkeit mitbestimmt und deutlich gemacht, dass die Strafverteidigung nicht nur den Interessen der jeweiligen Mandant:innen dient, sondern eine wichtige Rolle im Rechtsstaat und bei der Wahrung des fairen Verfahrens wahrnimmt.
Literaturverzeichnis:
Bauer-Raschhofer, Der Einfluss der Grundrechte auf die Gesetzgebung im Strafprozessrecht, JSt 2023, 312.
Birklbauer/Hirtenlehner/Schmollmüller, Anwaltliche Vertretung im Entlassungsverfahren aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe – empirische Ergebnisse und rechtspolitische Schlussfolgerungen, JSt 2023, 104.
Birklbauer/Stangl/ Soyer (Hrsg), Die Rechtspraxis des Ermittlungsverfahrens nach der Strafprozessreform (2011).
BMJ (Hrsg), Die Reform des Haupt- und Rechtsmittelverfahrens (2011).
Brandstetter, Zur Reform des strafprozessualen Hauptverfahrens, Verhandlungen des 15. österreichischen Juristentages in Innsbruck 2003. Band IV (1) (2003).
Dannecker, Strafrecht der Europäischen Gemeinschaft, in Eser/Huber (Hrsg), Strafrechtsentwicklung in Europa (1995) 26.
Fritsch, Fallkonferenzen im Jugendstrafrecht – Wenn schon, dann richtig! Handbuch für die Praxis (2023).
Jahn/Brodowski, Das Ultima Ratio-Prinzip als strafverfassungsrechtliche Vorgabe zur Frage der Entbehrlichkeit von Straftatbeständen, ZStW 2017, 129.
Lewisch in Fuchs/Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung § 357 (Stand 20. 12. 2018, rdb.at).
Haumer/Wiesinger, Betreuung von Klienten nach deren rechtskräftiger Verurteilung, in Kier/Wess (Hrsg), Handbuch Strafverteidigung. 2. Auflage (2022) Rz 16.1.
Hollaender/Mayerhofer, Das Gebot effizienten Rechtsschutzes und die Beschränkung des Zugangs zum OGH in Strafsachen durch dessen Judikatur, ÖJZ 2005, 447.
Kadric/Scheiber, Ausgangspunkt Tampere: Unterwegs zum europäischen Strafprozess, juridikum 2004/4, 207.
Kert, Grundrechtsschutz und gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, ÖJZ 2020, 719.
Kollmann/Silatani-Wiesbauer, Litigation PR im Strafrecht, in Bäck-Knapp/Harmer/Renzenbrink (Hrsg), Litigation PR (2021) 43.
Luef-Kölbl, Strafrecht als ultima ratio, in Hochmayr/Hinterhofer (Hrsg), Festschrift für Kurt Schmoller (2024) 65.
Meyer, Strafrechtsgenese in Internationalen Organisationen (2012).
Moos, Die Zweiteilung der Hauptverhandlung im Strafprozeß, ÖJZ 1983, 561.
Moos, Die Reform der Hauptverhandlung, ÖJZ 2003, 369.
Murschetz, Reform der Hauptverhandlung – adversatorische versus inquisitorische Hauptverhandlung, in Soyer/Ruhri/Stuefer (Hrsg), Strafverteidigung – Die Hauptverhandlung. Schriftenreihe der Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen. Band XXVI (2015) 43.
Murschetz, Neuerungen und Reformbedarf im Strafverfahren, AnwBl 2024, 704.
Pilnacek/Pscheidl, Das Strafverfahren und seine Grundsätze (Teil I), ÖJZ 2008, 629.
Reindl-Krauskopf, Christian Broda – Strafrechtliche Reformen mit nachhaltiger Wirkung, JSt 2016, 217.
Rohregger, Kollateralschäden im Strafverfahren – Was darf der Staat dem Beschuldigten zumuten?, JBl 2017, 219.
Sautner, Wie Armut den Zugang zum Recht beeinflusst. Die strafrechtliche Perspektive, JRP 2016, 135.
Schallmoser, Zwischen Erweiterung und Zurückdrängung, AnwBl 2019, 612.
Scheiber, Die Wahrung der Würde des Menschen in der gedolmetschten Kommunikation – eine Annäherung aus philosophischer und rechtlicher Sicht, in Kaindl/Pöllabauer/Mikic (Hrsg), Dolmetschen als Dienst am Menschen (2021), 135.
Schick, „Als Nächstes kommt die Hauptverhandlung dran“ (Anonymus) – Überlegungen zur Fortsetzung der Strafprozessreform, in Moos/Jesionek/Müller (Hrsg), Strafprozessrecht im Wandel (2006) 451.
Schirhakl/Tschurtschenthaler, 27. Forum der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte vom 18. bis 21. Juni 2018 am Walchsee in Tirol, RZ 2018, 208.
Schmoller, Zur Reform der Vernehmung in der Hauptverhandlung, RZ 2011, 188.
Schmoller, OGH: „Wahrer einheitlicher Rechtsauslegung“ oder „Schulmeister der Anwälte“?, in Giese/Holzinger/Jabloner (Hrsg), Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat. Festschrift für Harald Stolzlechner zum 65. Geburtstag (2013), 608.
Schmudermayer, Drei Jahre operative Tätigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft – Rückblick und Ausblick, JSt 2024, 577.
Schünemann, Reformaspekte des strafrechtlichen Haupt- und Rechtsmittelverfahrens, in BMJ (Hrsg), Die Reform des Haupt- und Rechtsmittelverfahrens (2011), 12.
Schroll/Oshidari in Fuchs/Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung Vorbem §§ 19–24 (Stand: 30. 3. 2025, rdb.at).
Schwaighofer, Die prozessordnungskonforme Ausführung von Nichtigkeitsbeschwerden – unvertretbare oder sinnvolle Anforderungen des OGH? ÖJZ 2020, 498.
Soyer, Zugang zu anwaltlichem Beistand – Notwendige Verteidigung, Pflicht- versus Verfahrenshilfeverteidigung, Prozesskostenhilfe, in Strafverteidigervereinigungen (Hrsg), Texte und Ergebnisse des 41. Strafverteidigertages Bremen, 24.-26. März 2017. Band XLI (2017), 127.
Soyer/Marsch, Stärken und Schwächen des Nichtigkeitsbeschwerdeverfahrens gemäß §§ 284 ff StPO, AnwBl 2018, 200.
Soyer/Marsch, VfGH zur Handysicherstellung; Eigentlich: VfGH zur Sicherstellung von Daten(-trägern) und IT-Endgeräten; Parallel: VfGH zum doppelten Rechtsschutz im Ermittlungsverfahren, JSt 2024, 118.
Stangl, Die neue Gerechtigkeit. Strafrechtsreform in Österreich 1954-1975 (1985).
Stuefer, Bedarf es einer Reform des Rechtsmittelverfahrens im Strafverfahren? JSt 2014, 105.
Wiederin in Fuchs/Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung § 5 (Stand: 30. 3. 2025, rdb.at).
Wiesinger/Surböck, Zur Verwendung von Privatsachverständigen im Strafverfahren, JSt 2023, 92.
[1] Bauer-Raschhofer, JSt 2023, 312; Soyer/Marsch, JSt 2024, 118 ff.
[2] Große Verbreitung fanden medial etwa im Strafverfahren sichergestellte Chats des früheren Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid. Neben diversen strafrechtlichen Ermittlungen hatten sie etwa auch den Rücktritt des Chefredakteurs der Tageszeitung Die Presse zur Folge (https://www.profil.at/oesterreich/nowak-an-schmid-ab-morgen-telefonieren-wir-taeglich/402206943; abgefragt am 10. 3. 2025).
[3] Rohregger, JBl 2017, 219.
[4] VfGH 14. 3. 2012, U 466/11.
[5] Zur Würde im Recht vgl Scheiber in Kaindl/Pöllabauer/Mikic, Dolmetschen.
[6] Luef-Kölbl in FS Schmoller 65; Jahn/Brodowski, ZStW 2017, 129.
[7] Wiederin in Fuchs/Ratz, WK StPO § 5 Rz 32 (Stand: 30. 3. 2025, rdb.at).
[8] Stangl, Die neue Gerechtigkeit. Strafrechtsreform in Österreich 1954-1975; Reindl-Krauskopf, JSt 2016, 217.
[9] Strafprozeßnovelle 1999 BGBl I 1999/55.
[10] https://www.neustart.at/opfer-tater-dialog/ (abgefragt am 17. 3. 2025).
[11] Soyer in Strafverteidigervereinigungen, Texte XLI 127.
[12] Maßnahme C, Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen oder beschuldigten Personen in Strafverfahren, ABl C 295 vom 04. 12. 2009.
[13] RL 2016/800/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind.
[14] Meyer, Strafrechtsgenese 181, spricht von „domaine réservé“; Dannecker in Eser/Huber, Strafrechtsentwicklung, 26 f.
[15] https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm (17. 3. 2025); vor dieser eigentlichen Harmonisierungswelle, die mit dem Rat von Tampere einsetzt, gab es im Rahmen der justiziellen Kooperation freilich schon einzelne Rechtsakte, die den Strafrechtssystemen der Mitgliedstaaten die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erleichtern sollten, etwa Auslieferungsübereinkommen. Vgl auch Kadric/Scheiber, juridikum 2004/4, 207-210.
[16] Kert, Grundrechtsschutz und gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, ÖJZ 2020, 719.
[17] Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, ABl L 190, 1. Die justizielle Zusammenarbeit in der Europäischen Union stützt sich auf Artikel 82 bis 86 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Eine Zusammenstellung der bisher auf dieser Grundlage ergangenen Rechtsakte findet sich hier: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/155/justizielle-zusammenarbeit-in-strafsachen (abgefragt am 22. 3. 2025).
[18] Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren.
[19] RL 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer; RL 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie; RL 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung; RL 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten.
[20] Unter dem Titel gemeinsamer Mindeststandards für Strafverfahren wurden bislang folgende Richtlinien erlassen: RL 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren; RL 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren; RL 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs; RL 2016/343/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren; RL 2016/800/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind; RL 2016/1919/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls.
[21] S FN 13.
[22] RL 2024/1203/ EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Ersetzung der Richtlinien 2008/99/EG und 2009/123/EG.
[23] RL 2024/1385/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.
[24] Beschluss des Rates vom 28. Februar 2002 über die Errichtung von Eurojust zur Verstärkung der Bekämpfung der schweren Kriminalität, ABl 2002 L 63 v 05. 03. 2002.
[25] VO 2017/1939/EU des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA).
[26] Schmudermayer, JSt 2024, 577.
[27] https://help.elearning.ext.coe.int/ (abgefragt am 20. 03. 2025).
[28] Strafprozessreformgesetz BGBl I 2004/19.
[29] Lewisch in Fuchs/Ratz, WK StPO § 357 (Stand 20. 12. 2018, rdb.at); Schirhakl/Tschurtschenthaler, RZ 2018, 208.
[30] IdS Schroll/Oshidari in Fuchs/Ratz, WK StPO Vorbem §§ 19–24 Rz 2 (Stand: 30.3.2025, rdb.at).
[31] Allgemein zu den Möglichkeiten der Verteidigung im neuen Ermittlungsverfahren vgl Pilnacek/Pscheidl, ÖJZ 2008, 629-634 und Birklbauer/Stangl/ Soyer, Rechtspraxis 165, 425. Konkret zu den Auswirkungen der (mangelnden) anwaltlichen Vertretung: Sautner, JRP 2016, 135.
[32] Wiesinger/Surböck, JSt 2023, 92.
[33] Kollmann/Silatani-Wiesbauer in Bäck-Knapp/Harmer/Renzenbrink, Litigation 43 ff.
[34] Schick in FS Miklau 431: „Als Nächstes kommt die Hauptverhandlung dran“ (Anonymus) – Überlegungen zur Fortsetzung der Strafprozessreform; BMJ (Hrsg), Reform.
[35] Eingehend zum aktuellen Reformbedarf im Strafverfahren Murschetz, AnwBl 2024, 704 ff; spezifisch zur Hauptverhandlung: Murschetz in Soyer/Ruhri/Stuefer, Strafverteidigung XXVI 43.
[36] Konkret zu den Nachteilen des Inquisitionsprinzips bei der Vernehmung: Schmoller, RZ 2011, 188.
[37] Aus deutscher Sicht so beschrieben: „Die Vielfalt der Richterrollen in der gegenwärtigen österreichischen Hauptverhandlung verblüfft aus deutscher Sicht vor allem durch die scharfe Ausprägung der Extreme.“ Schünemann in BMJ, Reform 12.
[38] Murschetz, AnwBl 2024, 307.
[39] Moos, ÖJZ 2003, 369-381; und bereits lange vor der Vorverfahrensreform: Moos, ÖJZ 1983, 561 ff. Vgl auch Brandstetter, 15. JT 2003. IV.
[40] Fritsch, Fallkonferenzen.
[41] Schallmoser merkt an, dass es sich mehr um richterliche Rechtsfortbildung denn um Auslegung handelt und zeigt (so wie Hollaender/Mayerhofer – s folgende FN) die verfassungsrechtliche Problematik dieser Rechte-einschränkenden Rechtsfortbildung auf: Schallmoser, AnwBl 2019, 612 (616 f).
[42] Hollaender/Mayerhofer, ÖJZ 2005, 447 (454 f).
[43] OGH 11. 2. 2003, 11 Os 2/03 = JBl 2003, 884 (Bertel); Schmoller in FS Stolzlechner 608, 614 f; Schwaighofer, ÖJZ 2020, 498; Soyer/Marsch, AnwBl 2018, 200; Stuefer, JSt 2014, 105.
[44] Für den Austausch zur Frage der Formalisierung des Rechtsmittelverfahrens, aber auch zu anderen Punkten dieses Beitrags und für viele Denkanstöße danke ich Univ.-Ass. Mag.a Laura Viktoria Elsenhans (Universität Innsbruck).
[45] Kritisch zur mangelnden notwendigen Verteidigung vor dem Vollzugsgericht:
Haumer/Wiesinger in Kier/Wess2 Rz 16.2 (Stand: 30. 3. 2025, rdb.at).
[46] An diesem Erfordernis ändert auch nichts, dass eine aktuelle Untersuchung keine signifikante Auswirkung der Vertretung auf die Entscheidung der Vollzugsgerichte ergibt: Birklbauer/Hirtenlehner/Schmollmüller, JSt 2023, 104-112.
[47] § 61 Abs 1 StPO.
Beiträge per Email abonnieren