Rezension von NEWS online zu „Sozialdemokratie: Letzter Aufruf!“, 21.3.2019
SPÖ: 10 Tipps
zur Auferstehung
Der Weckruf eines besorgten Bürgers
https://www.news.at/a/spoe-krise-tipps-auferstehung-10690600
Die Sozialdemokratie ist in der Krise, die SPÖ verliert kontinuierlich. Das ist weder ein Geheimnis, noch eine Neuigkeit. Doch wie könnte der Weg aus dieser Krise aussehen? Zehn Vorschläge dafür liefert der Jurist und zivilgesellschaftlicher Aktivist Oliver Scheiber in seinem Weckruf „Sozialdemokratie: Letzter Aufruf!“
Oliver Scheiber ist kein Politiker, kein Polit-Experte, nicht einmal Mitglied einer politischen Partei. Der Jurist und Publizist hat vielmehr als „Bürger und politischer Beobachter“, wie er seine Rolle als Autor gegenüber News.at definiert, einen „letzten Aufruf“ bzw. einen Weckruf an die österreichische Linke, allen voran die SPÖ, publiziert.
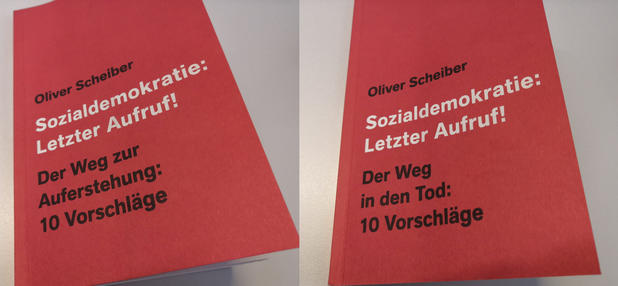
1. Solidarität
Zudem spricht er einen Vorschlag aus, der in der Bevölkerung wohl umgehend großen Anklang finden würde: Die Garantie auf Urlaub. Dass viele Menschen nicht auf Urlaub fahren können, würde einem reichen Land wie Österreich nicht entsprechen. Also solle in einem ersten Schritt garantiert werden, dass jedes Kind im Jahr zumindest zwei Wochen auf Urlaub fahren könne
, in einem zweiten Schritt jede Familie.
Zudem müsse sich die Sozialdemokratie bedingungslos für kostenlose Kinderbetreuungsplätze
einsetzen, ebenso wie die Pflege
im Alter oder bei Krankheit sicherstellen.
, deren oftmaliger Wechsel in Konzerne nach Politik-Ende, ebenso wie auch deren Überheblichkeit und protziger Lebensstil, diese massiv beschädigt habe. „Immer mehr SozialdemokratInnen unterwarfen sich den Wünschen der Konzerne und des Finanzkapitals“, schreibt Scheiber und fordert eine Rückgewinnung der Handlungshoheit der Politik über die Wirtschaft.
. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt der Autor hier als positives Beispiel.
(„Die Sozialdemokratie muss eine neue Schule fordern, die Begabungen fördert und nicht wie bisher Schwächen sanktioniert“), Klimaschutz
sowie moderne Gleichstellungspolitik
( über Quoten) angeführt.
2. Politische Arbeit
zu suchen. Dies kann er sich etwa in Form von Bürgersprechstunden vorstellen, wobei die Wünsche der Bevölkerung aufgenommen und dann innerhalb weniger Tage abgearbeitet werden.
oder einer Sammlung von Initiativen und Projekten arbeiten, um ihre Schwerfälligkeit zu verlieren.
3. Kommunikation
und eigene Kanäle aufgebaut werden (Stichwort Social Media); aber „nicht so ungeschickt wie bisher“.
4. Personelle Breite
des Landes anzusprechen, runde Tische einzuführen, IdeengeberInnen und ExpertInnen in Form von Think Tanks zusammenzuführen. Denn es gäbe zwar jetzt schon eine Vielzahl ambitionierter und hochbegabter Menschen innerhalb der SPÖ, doch „sie werden geradezu systematisch ausgebremst“, findet Scheiber. Kritisches Denken würde bestraft, kluge Ideen im Keim erstickt, Veränderungen als Gefahr betrachtet.
Verzichtet werden soll im Gegenzug auf große Beraterstäbe wie etwa Spin-Doktoren in Form eines Tal Silberstein und mehr auf kleine, qualifizierte Mitarbeiterteams gesetzt werden.
5. Strukturen
bekommen, die innere Demokratie aber dennoch gewahrt wird – nur anders wie zum Beispiel in Form eines schnelleren und unkomplizierteren Online-Votings. Als positives Beispiel finden hier die Strukturen der NEOS Erwähnung.
6. Vision und Aktion
der SPÖ seien seit langem nur noch „leere Worthülsen“
urteilt Scheiber. Diesen würden zu wenig Taten folgen. Für vieles, wie etwa die Neugestaltung des öffentlichen Raums oder etwa die Einrichtung von Korruptionsmeldestellen, brauche es nicht unbedingt eine Regierungsbeteiligung, vieles könne auch aus der Opposition heraus
passieren. Die SPÖ müsse aktiv werden und sich mehr trauen.
, denn „nicht die Mindestsicherung ist zu hoch, die Mindestlöhne sind zu niedrig.“ Die Linke müsse für eine 40-Stunden-Woche einen Mindestlohn von 2.000 Euro netto einfordern.
7. Wirtschaft
, denn die Wirtschaft habe bereits „global die Herrschaft über die Politik übernommen.“ Die Sozialdemokratie müsse zwar als Wirtschaftsvertretung ageiren, aber nicht als jene von globalen Konzernen sondern vielmehr von Unternehmen, „die mit Rücksicht auf Umwelt und Arbeitsschutz gemeinsam mit ihren ArbeitnehmerInnen den Wohlstand garantieren.“
. Auch mit Vorbildwirkung aus politischer Sicht, denn „wer mehr als das Zehnfache des Mindestlohns verdient, soll das Darüberhinausgehende in ein Sozial- oder Bildungsprojekt einzahlen oder nicht Mitglied der SPÖ/SPD sein.“
8. Transparenz und starker Staat
Ein starker Staat
impliziere natürlich auch Sicherheit
, allerdings nicht in Form des derzeitigen „Sicherheitswahns“, der bloß ebenso teuer wie ineffizient sei und das gesellschaftliche Klima vergifte. Vielmehr schlägt Scheiber vor, sich an anderen Ansätzen zu orientieren, wie etwa dem schottischen, wo Kriminalität als „Public Health Issue“ gesehen wird. Um die Verbreitung einzudämmen, werden dort Maßnahmen zur Verhaltensänderung und Änderung sozialer Normen in Gruppen gesetzt.
9. Strategie
mit Grünen und linken Parteien sowie in Grundrechtsfragen mit Liberalen und Neos fordert Scheiber von der Sozialdemokratie ebenfalls ein. Dies könne sogar ein gemeinsames Antreten bei Wahlen bedeuten. Zudem müsse die SPÖ viel mehr im ländlichen Raum
werben und dort auch dem Wien-Bashing entgegentreten
und stattdessen Wiens gute städtische Leistungen – ein Vorzeigemodell – hervorheben. Für Wien selbst fordert er eine „Wiener Stadtbürgerschaft“
für alle, die seit mindestens zwei Jahren in der Bundeshauptstadt leben. Diese soll viele Mitbestimmungsrechte geben und so zur besseren Integration beitragen.
10. Internationalität und Europa
Buchpräsentation im Volkstheater – Sonntag, 17. März 2019, um 11 Uhr
Dass alle Plätze für die Präsentation am kommenden Sonntag im Volkstheater ganz schnell vergeben waren, freut mich einerseits; andererseits ist es schade, dass viele, die gerne gekommen wären, nun nicht dabei sein können. Wir (ich und FreundInnen) überlegen gerade, ob und wie wir weitere Veranstaltungen organisieren können – dann aber vielleicht themenbezogen oder als weiterführende, kleinere zivilgesellschaftliche Initiativen.
In jedem Fall freue ich mich auf den Sonntag und danke den Podiumsgästen für Ihr Teilnahme.
in der Roten Bar des Volkstheaters
17. März 2019, um 11 Uhr
GRÜNEN in Wien)
JETZT)
unter aufruf@gmx.at
Erscheint am 5.3.2019: Sozialdemokratie – letzter Aufruf!
Im 1. Bezirk:
Buchhandlung „Der Buchfreund“, 1010 Wien, Sonnenfelsgasse 4 (fünf Min. vom Stephansplatz, www.buch-schaden.at)
Im 7. Bezirk:
Buchhandlung Posch, Lerchenfelder Str. 91-93, 1070 Wien, https://poschbuchhandlung.at/buchhandlung-posch.html
Infos zum Versand des Buches unter aufruf@gmx.at.
Buchpräsentation am Sonntag, 17. März 2019, um 11.00 Uhr, in der Roten Bar des Volkstheaters in Wien
http://www.volkstheater.at/stueck/sozialdemokratie-l
Die Hüter der Grundrechte – Text für DIE ZEIT 3/2019
Die Hüter der Grundrechte
Ein Gastbeitrag von Oliver Scheiber
Der nächste brisante Fall für den Verfassungsgerichtshof nimmt bereits Gestalt an. Nach den Plänen der Regierung sollen bei der Reform der Mindestsicherung vorzeitig aus der Haft entlassene Straftäter, die zu mehr als sechs Monaten Gefängnis verurteilt waren, bis zum regulären Strafende keine Mindestsicherung mehr erhalten. Kommt es zu solch einem Beschluss im Parlament, dann wird die Regelung wohl vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) landen, weil sie im Konflikt mit dem Gleichheitsgrundsatz stehen dürfte. Es wäre dies ein weiteres Puzzlestück in einer Serie jüngster Reformen, die rasch vor dem Höchstgericht landeten.
mehrere Regierungsprojekte als verfassungswidrig qualifiziert und aufgehoben.
Damit wird die Rolle des Verfassungsgerichts in der politischen Arena
prominenter und auch die Frage der Richterbesetzungen erhält Brisanz.
erlebt Österreich seit einigen Jahren durchaus im europäischen Trend eine Phase
des Rückbaus von Menschenrechten und eine Infragestellung rechtsstaatlicher
Errungenschaften.
repressive Seite des Staates tritt stärker hervor und bedeutet eine Schwächung
der Bürgerrechte. Man denke nur an die vielen Überwachungsmaßnahmen.
Angetrieben wird diese Schwächung des Grundrechtssystems und der
Rechtsstaatlichkeit einerseits vom autoritär orientierten Rechtspopulismus,
andererseits – und schon länger – von einer repressiven Polizei- und
Strafrechtspolitik in Folge der islamistischen Terroranschläge seit 9/11. In
Österreich hat dieser Prozess durch die populistische Instrumentalisierung der
Fluchtbewegung ab 2015 an Dynamik gewonnen. Seither werden die in der Genfer
Flüchtlingskonvention und Menschenrechtskonvention gewährten Menschenrechte
offen in Frage gestellt. Im Fremdenrecht überschreitet der Staat immer häufiger
rote Linien der Menschenrechte, bei Sozialleistungen werden schwache
Personengruppen wie Fremde, aber auch Haftentlassene diskriminiert.
Jahren abgezeichnet. Die Regierung Kurz bzw. einzelne Landesregierungen, an
denen die FPÖ beteiligt ist, scheut vor selbstbewusst vorgetragenen
Grenzüberschreitungen in Verfassungsfragen nicht zurück.
Parlament, völlig frei agieren kann. Die österreichische Verfassung sieht
vielmehr, ähnlich anderen demokratischen Rechtsstaaten, ein System der checks and balances vor. Gesetzgebung,
Verwaltung und Gerichtsbarkeit kontrollieren einander wechselseitig, keine
Institution verfügt über uneingeschränkte Macht. Die Kontrolle der Gesetzgebung
ist in erster Linie Sache des Verfassungsgerichtshofs. Er überprüft die
Verfassungsmäßigkeit der Gesetze. Seit Antritt der Regierung Kurz hat der
Gerichtshof bereits mehrere Gesetzesprojekte oder neue Verwaltungspraktiken,
wie zuletzt den Entzug österreichischer Staatsbürgerschaften, aufgehoben oder
gestoppt.
politischen System hat die jeweilige Regierung eine starke Rolle. Sie ist es in
der Regel, die dem Parlament Gesetzesvorschläge übermittelt und diese dort
mittels ihrer Parlamentsmehrheit und eines strikt gehandhabten Klubzwangs mehr
oder weniger durchwinkt. Das Selbstbewusstsein der Mandatare ist nicht
übermäßig ausgeprägt; die ÖVP-Fraktion stimmte binnen kurzer Zeit zuerst für
ein strenges Rauchverbot in der Gastronomie, nach dem Regierungswechsel
dagegen. Die Regierung Kurz hat die
Diskussion über einige Regierungsvorschläge de facto ausgehebelt, indem sie die
Gesetzesentwürfe nur binnen ganz kurzer Fristen begutachten lässt. Zudem hat
der ehemals renommierte Verfassungsdienst der Regierung durch seine
Verschiebung vom Bundeskanzleramt ins Justizministerium an Einfluss verloren. Er
war bisher eine angesehene Stimme in Verfassungsfragen, nunmehr spielt er kaum
mehr eine Rolle in der politischen Willensbildung. All dies erleichtert die
rasche Beschlussfassung von Gesetzen, die im Spannungsfeld zu Verfassung und
Grundrechten stehen. Die Verwaltung ist zur Umsetzung der einmal beschlossenen
Gesetze verpflichtet. Die Neigung, Bedenken gegen eine politische erwünschte
Vorgangsweise zu äußern, ist in einer von Obrigkeitshörigkeit gekennzeichneten heimischen
Verwaltung wenig ausgeprägt.
Verfassung und zentraler Grundrechte wie des Gleichheitssatzes oder des fairen
Verfahrens nicht ganz allein. In der BVT-Affäre konnte das Kabinett des
Innenministers seine Vorstellungen polizeiintern und bei Staatsanwaltschaft und
Erstgericht schnell durchsetzen, auf der Ebene des Oberlandesgerichts wurde die
Dynamik des Systems Kickl jedoch gestoppt. Die durchgeführten
Hausdurchsuchungen wurden als nicht gesetzeskonform qualifiziert.
Verfassungsgerichtshof ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Gerichtshof erfüllt,
wie alle Verfassungsgerichte, eine politische Funktion. Das ergibt sich aus
seiner Aufgabe, die ihm die Verfassung selbst zuweist. Indem der Gerichtshof
Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüft, wird er zum Akteur des politischen
Prozesses. Dies wird in gesellschaftlich wichtigen Fragen wie im Familienrecht
deutlich und bei allen Fragen, die medial stark diskutiert werden, etwa der
Anfechtung der Bundespräsidentschaftswahl. Es ist folgerichtig, dass sich die
Politikwissenschaft vermehrt der Rolle des Gerichts zuwendet. Die
Politikwissenschaftlerin Tamara Ehs hat wichtige Forschungsprojekte zur Rolle
des VfGH geleitet, die die traditionellen Forschungen der Rechtswissenschaft
ergänzen. In der Zusammenschau zeigt sich, dass das österreichische
Verfassungsgericht sein Rollenverständnis im Laufe seines Bestehens verändert
hat. Lange Zeit verfolgte der Verfassungsgerichtshof gerade im
Grundrechtsbereich ein zurückhaltendes Rollenverständnis. Seit den
1980er-Jahren legt der Gerichtshof seine Rolle in Grundrechtsfragen aktiver an.
Die überwiegende Expertenmeinung geht dahin, dass das Gericht sich eher als
Kontrollorgan denn als politischer Entscheidungsträger versteht. Angelehnt an
das Verständnis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die
Einhaltung der Menschenrechtskonvention prüft, ist auch der
Verfassungsgerichtshof zu feineren Prüfungen übergegangen und nutzt den
Gleichheitssatz dazu, die Grundrechte im Wege der Interpretation fortzuentwickeln.
So gehen etwa viele Entwicklungen des Familienrechts, wie z.B. die Ehe für
alle, auf die Rechtsprechung des VfGH zurück.
des hohen Gerichts einen Schutzwall um die Verfassung errichten, wenn
autoritäre Tendenzen zunehmen? Oder gibt es Loyalitäten zur Regierung, die sie
daran hindern? Der Verfassungsgerichtshof besteht aus einer Präsidentin und
einem Vizepräsidenten sowie zwölf weiteren Richterinnen und Richtern, dazu
kommen sechs Ersatzmitglieder. Alle sind unversetzbar und unabhängig, das Amt
endet mit dem 70. Lebensjahr. Sie sind keine Berufsrichter und üben im
Regelfall eine oder mehrere weitere Tätigkeiten aus. Bei Neubesetzungen gibt es
verschiedene Vorschlagsmodi, im Ergebnis wählt aber die jeweilige
Regierungsmehrheit die Richterinnen und Richter aus. Der frühere VfGH-Präsident
Ludwig Adamovich formulierte es so: „Es kommt niemand hinein, der nicht das
Vertrauen einer politischen Kraft hat. Doch dass die Richter deshalb wie
ferngesteuerte Zinnsoldaten agieren, ist nicht wahr.“ Das gilt bisher so.
die Öffentlichkeit erfährt nicht, wie Abstimmungen im Richterkollegium
ausgegangen sind und es gibt auch kein Sondervotum einzelner Richter, wie es
viele andere Staaten kennen. Dies hat den Nachteil, dass der Diskussionsprozess
innerhalb des Gerichts nicht transparent ist; zugleich bietet es den Vorteil,
dass die Richter im Schutz der Vertraulichkeit entsprechend ihrer Überzeugung
abstimmen können und nicht unter Druck der Partei kommen, die sie nominiert
hat. Dieses Prinzip hat bisher gut funktioniert; der Verfassungsgerichtshof
geriet seit 1945 nie in den Verdacht, Erfüllungsgehilfe der jeweiligen
Regierung zu sein. Vielmehr bescheinigt die Wissenschaft dem VfGH ein hohes
Ausmaß an Autonomie gegenüber aktuellen politischen Strömungen. So fanden alle
Parteien genügend Anlässe, sich über Entscheidungen zu ärgern. Aktuell werden
neun der 14 Verfassungsrichter den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ zugerechnet;
nichtsdestotrotz fällen sie Urteile, die den Vorstellungen der Regierung Kurz
zuwiderlaufen.
Zusammenhang mit dem Höchstgericht Tabubrüche setzt. Sie tat dies durch
persönliche Beleidigungen des früheren Präsidenten Adamovich ebenso wie durch
jahrelanges Ignorieren der Urteile zu zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten –
ein beispielloser Vorgang in der Zweiten Republik. Deshalb finden die
Richternominierungen, die die FPÖ nun als Regierungspartei vornimmt, besondere
Beachtung. Im Frühjahr 2018 soll ein verfassungsjuristisch nicht ausgewiesener
Jurist und Kronenzeitung-Kolumnist als Verfassungsrichter im Gespräch gewesen
sein. Auch wenn es ein Gerücht gewesen sein mag; es beunruhigt allein die
Tatsache, dass seine Nominierung für möglich gehalten wurde.
fachlich anerkannten Medienrechtsanwalt und einen Linzer Rechtsprofessor. Beide
wurden ernannt. Mit dem Linzer Professor setzte die Regierung einen Tabubruch, hatte
dieser doch Europa als „multikriminelle Gesellschaft“ bezeichnet, an deren Entstehung
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Mitverantwortung trage. Damit
arbeitet nun jemand am höchsten Gericht, der offenbar den Grundkonsens des
Nachkriegseuropas, die Absage an Nationalismus und Hass, nicht mitträgt. Die
zitierte Aussage stellt nicht nur die Assoziation von mulitikulturell und
kriminell her, sie kommuniziert zugleich die Ablehnung supranationaler Gerichte
mit. Man wird sehen, wie sehr es dem Richterkollegium gelingt, eine solche
Persönlichkeit in die gemeinsame Grundrechtstradition einzubinden.
unterschätzte politisch-strategische Entscheidung, bleiben die Richter doch bis
zum 70. Lebensjahr im Amt. Regierungen treffen damit weit über ihre eigene
Amtszeit hinaus gesellschaftspolitische Weichenstellungen. In den kommenden zehn
Jahren stehen nur drei Nachbesetzungen am Verfassungsgericht an, ab 2029 kommt
es dann jedenfalls zu einer Verjüngungswelle mit sechs weiteren Neubesetzungen.
Mittelfristig darf man also darauf vertrauen, dass der Verfassungsgerichtshof
seine Rolle als Bewahrer des gewachsenen europäischen Menschenrechtssystems
entschlossen wie bisher ausübt.
Wien und FH Wien sowie Vorsitzender des Vorstands des Instituts für Rechts- und
Kriminalsoziologie. Er gibt hier seine persönliche Ansicht wieder.

