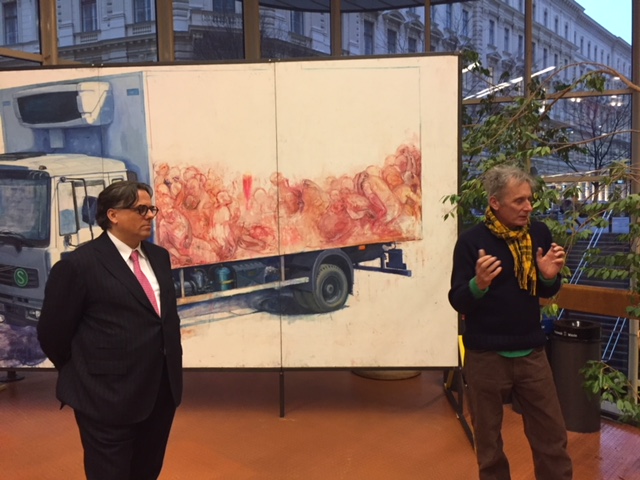Zwei Beispiele zeigen, wie weit die vom
Rechtspopulismus betriebene Vergiftung des politischen und gesellschaftlichen
Klima in Europa fortgeschritten ist. In Niederösterreich wurden gestern zwei Asylwerber, einer aus Afghanistan,
der andere aus Somalia stammend, vom Vorwurf freisprochen, ein 15-jähriges
Mädchen vergewaltigt zu haben. In (sozialen) Medien ergoss sich darauf ein
Shitstorm über die Justiz. Der Freispruch sei unvertretbar und skandalös; eine ähnliche
Wortwahl fand der Vizekanzler. Aus der Landespolitik verlautete, den beiden
Männern werde die Grundversorgung gestrichen. Ich habe gestern mit einigen
sonst durchaus reflektierten Menschen über das Urteil gesprochen; der Gedanke,
dass junge männliche Asylwerber vom Vorwurf der Vergewaltigung eines
einheimischen Mädchens freigesprochen werden, oder dass sie gar unschuldig sein
könnten, scheint keine ernsthafte Möglichkeit mehr zu sein. Und es werden viele
Aspekte völlig unsachlich und undifferenziert durcheinander geworfen. Natürlich
sollte der Opferschutz in Österreich verbessert werden: es geht dabei nicht um
die Strafen, sondern um die Rahmenbedingungen im Verfahren. Es soll nicht drei,
vier, fünf Einvernahmen eines Opfers geben, sondern eine einzige, umsichtig und
professionell durchgeführte und mit Video dokumentierte; das Opfers soll auf ganz
einfache Weise Anzeige erstatten können, bestmöglich begleitet und geschützt
werden. Hier soll und muss im Interesse der Opfer viel verbessert werden. Und
umgekehrt dürfen wir die Rechte der Verdächtigen nicht über Bord werfen. Die
Unschuldsvermutung ist ein zentrales zivilisatorisches Element des
Strafverfahrens. Und es gibt gemeinsame Interessen von Verdächtigen und Opfern:
etwa die rasche Durchführung des Verfahrens, um die emotionale Belastung so
gering wie möglich zu halten. Bei der Diskussion über das Urteil wird auf
vieles vergessen: auf den zentralen Grundsatz, dass im Zweifel freizusprechen
ist. Der Freispruch bedeutet nicht, dass das Opfer nicht vergewaltigt wurde. Es
bedeutet nur, dass die Richter nicht völlig sicher waren. Dieser
Zweifelsgrundsatz gilt bei einer Vergewaltigung genau so wie bei einem Diebstahl
oder Betrugsverfahren. Wir können diesen Grundsatz nicht aufgeben. Es war im
Übrigen ein gemischter Senat aus Berufs- und Laienrichtern: es ist also auch
müßig, aus diesem Anlassfall heraus ein Berufs- oder Laienrichterbashing zu
betreiben. Und noch eines sollte man bedenken: keine Gruppe hat derzeit wohl
vor österreichischen Behörden einen schwereren Stand als junge männliche
Asylwerber. Diese Menschen sind stigmatisiert, sie haben es bei Wohnungs- und
Jobsuche schwerer als andere, und genau so bei Behördenverfahren. Dass sie in
einem Gerichtsverfahren unsachlich milde behandelt würden, ist absurd und lebensfremd.
Studien belegen, dass ausländische Verdächtige von der Justiz strenger
behandelt werden als österreichische Verdächtige.
Rechtspopulismus betriebene Vergiftung des politischen und gesellschaftlichen
Klima in Europa fortgeschritten ist. In Niederösterreich wurden gestern zwei Asylwerber, einer aus Afghanistan,
der andere aus Somalia stammend, vom Vorwurf freisprochen, ein 15-jähriges
Mädchen vergewaltigt zu haben. In (sozialen) Medien ergoss sich darauf ein
Shitstorm über die Justiz. Der Freispruch sei unvertretbar und skandalös; eine ähnliche
Wortwahl fand der Vizekanzler. Aus der Landespolitik verlautete, den beiden
Männern werde die Grundversorgung gestrichen. Ich habe gestern mit einigen
sonst durchaus reflektierten Menschen über das Urteil gesprochen; der Gedanke,
dass junge männliche Asylwerber vom Vorwurf der Vergewaltigung eines
einheimischen Mädchens freigesprochen werden, oder dass sie gar unschuldig sein
könnten, scheint keine ernsthafte Möglichkeit mehr zu sein. Und es werden viele
Aspekte völlig unsachlich und undifferenziert durcheinander geworfen. Natürlich
sollte der Opferschutz in Österreich verbessert werden: es geht dabei nicht um
die Strafen, sondern um die Rahmenbedingungen im Verfahren. Es soll nicht drei,
vier, fünf Einvernahmen eines Opfers geben, sondern eine einzige, umsichtig und
professionell durchgeführte und mit Video dokumentierte; das Opfers soll auf ganz
einfache Weise Anzeige erstatten können, bestmöglich begleitet und geschützt
werden. Hier soll und muss im Interesse der Opfer viel verbessert werden. Und
umgekehrt dürfen wir die Rechte der Verdächtigen nicht über Bord werfen. Die
Unschuldsvermutung ist ein zentrales zivilisatorisches Element des
Strafverfahrens. Und es gibt gemeinsame Interessen von Verdächtigen und Opfern:
etwa die rasche Durchführung des Verfahrens, um die emotionale Belastung so
gering wie möglich zu halten. Bei der Diskussion über das Urteil wird auf
vieles vergessen: auf den zentralen Grundsatz, dass im Zweifel freizusprechen
ist. Der Freispruch bedeutet nicht, dass das Opfer nicht vergewaltigt wurde. Es
bedeutet nur, dass die Richter nicht völlig sicher waren. Dieser
Zweifelsgrundsatz gilt bei einer Vergewaltigung genau so wie bei einem Diebstahl
oder Betrugsverfahren. Wir können diesen Grundsatz nicht aufgeben. Es war im
Übrigen ein gemischter Senat aus Berufs- und Laienrichtern: es ist also auch
müßig, aus diesem Anlassfall heraus ein Berufs- oder Laienrichterbashing zu
betreiben. Und noch eines sollte man bedenken: keine Gruppe hat derzeit wohl
vor österreichischen Behörden einen schwereren Stand als junge männliche
Asylwerber. Diese Menschen sind stigmatisiert, sie haben es bei Wohnungs- und
Jobsuche schwerer als andere, und genau so bei Behördenverfahren. Dass sie in
einem Gerichtsverfahren unsachlich milde behandelt würden, ist absurd und lebensfremd.
Studien belegen, dass ausländische Verdächtige von der Justiz strenger
behandelt werden als österreichische Verdächtige.
Ähnlich instrumentalisiert wie das Strafverfahren in
Niederösterreich wurde der Mord an einer jüdischen Holocaust-Überlebenden in
Paris. Er wird zu einer weiteren Eskalation in der Hetze gegen Menschen
muslimischen Glaubens genutzt. Und natürlich gibt es einen wahren Kern: einen Antisemitismus, der von islamischen Staaten, Politikern,
Religionsführern genährt und betrieben wird; das ist genau so unerträglich wie
antisemistische Haltungen, die seit Jahrhunderten in Europa bestehen.
Jedenfalls: die Mehrheit der Menschen muslimischen Glaubens lebt friedlich in
Europa. Der Antisemitismus, der in Europa zur Ermordung von Millionen Juden
geführt hat, war genuin europäisch. Wir müssen jede Form von Antisemitismus und
Gewalttat und all ihre Ursachen ganz entschieden bekämpfen, ohne daraus so
plumpen Schlüssen wie der Ablehnung von ethnischen Gruppen, Religionen oder
Migration an sich nachzugeben.
Niederösterreich wurde der Mord an einer jüdischen Holocaust-Überlebenden in
Paris. Er wird zu einer weiteren Eskalation in der Hetze gegen Menschen
muslimischen Glaubens genutzt. Und natürlich gibt es einen wahren Kern: einen Antisemitismus, der von islamischen Staaten, Politikern,
Religionsführern genährt und betrieben wird; das ist genau so unerträglich wie
antisemistische Haltungen, die seit Jahrhunderten in Europa bestehen.
Jedenfalls: die Mehrheit der Menschen muslimischen Glaubens lebt friedlich in
Europa. Der Antisemitismus, der in Europa zur Ermordung von Millionen Juden
geführt hat, war genuin europäisch. Wir müssen jede Form von Antisemitismus und
Gewalttat und all ihre Ursachen ganz entschieden bekämpfen, ohne daraus so
plumpen Schlüssen wie der Ablehnung von ethnischen Gruppen, Religionen oder
Migration an sich nachzugeben.
Derzeit ist offenbar jeder Anlass gut, um Minderheiten
gegeneinander auszuspielen und auf schwache Gruppen einzuprügeln. Zu viele
Politiker und Medien lassen sich darauf ein. Wir wissen aus der Geschichte,
dass das ganz schnell ins Unheil für alle führt.
gegeneinander auszuspielen und auf schwache Gruppen einzuprügeln. Zu viele
Politiker und Medien lassen sich darauf ein. Wir wissen aus der Geschichte,
dass das ganz schnell ins Unheil für alle führt.