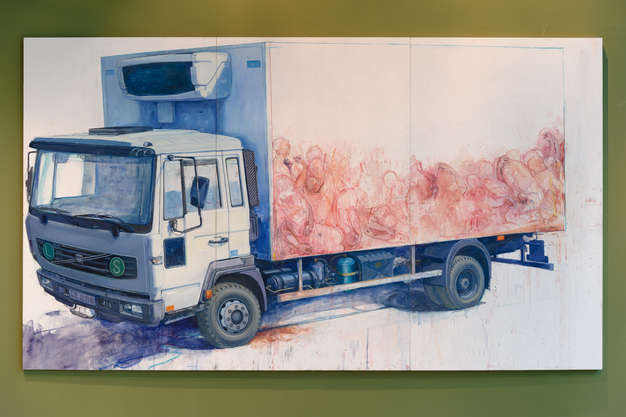Ein steirischer Arzt wurde vor Kurzem unter anderem vom Vorwurf freigesprochen, seine Kinder gequält zu haben. Das Urteil bewertet laut Medienberichten das äußere Erscheinungsbild der Kinder; über eine Tochter heißt es, sie lege „offensichtlich auf Kleidung, dem Anlass entsprechend, keinen Wert“. Die Exfrau des Angeklagten wird als „überladene Person“ bezeichnet.
Die Wortwahl des Urteils ist schwer mit bestehenden Vorgaben für die Formulierung von Urteilen in Einklang zu bringen. Das Gesetz verlangt von Richtern verständliche Erledigungen. Die Ausdrucksweise müsse „richtig und der Würde des Gerichts angepasst sein. Ausführungen, die nicht zur Sache gehören oder jemanden ohne Not verletzen könnten, sind unzulässig“, heißt es im Gesetz.
Die Bevölkerung erwartet mit Recht, dass gerichtliche Schriftstücke und Äußerungen von Richtern niemanden herabsetzen oder beleidigen; keine Opfer, aber auch keine Angeklagten oder Zeugen. Richter müssen die Wirkung ihrer Worte bedenken. Werden Menschen in Urteilen bloßgestellt, so kann das weitere Opfer von Straftaten davor abschrecken, Anzeige zu erstatten oder auszusagen. Rechtsprechung hat viel mit Grundrechten und der Würde von Menschen zu tun. Deshalb bemühen sich die Verwaltungen der Justizsysteme weltweit, bei der Auswahl und Ausbildung der Richter der Persönlichkeit der Kandidaten mehr Bedeutung beizumessen.
Persönliche Unterstellungen
Gerichtsverhandlungen sind öffentlich, damit Vertrauen in die Justiz entsteht. Gerichte sind nicht sakrosankt, die Meinungsfreiheit berechtigt Medien und Bürger, gerichtliche Entscheidungen zu kritisieren. Für die Weiterentwicklung unseres Rechts ist die kritische Fachdiskussion über Urteile wichtig. Heikel wird Kritik, wenn sie, wie im Fall des Flughafen-Urteils, mit persönlichen Unterstellungen gegen Richter arbeitet.
Umgekehrt ist es wichtig, dass Urteile wie jenes aus Graz aus der Richterschaft selbst kritisiert werden. Denn die große Mehrheit der Richterinnen und Richter leistet gute Arbeit und bedient sich einer anderen Sprache und eines anderen Tons als das Grazer Urteil. Die neue Präsidentin der Richtervereinigung meinte, sie könne die Bedenken gegen die Wortwahl des Urteils nachvollziehen und sieht auch eine Verletzung der Vorgaben der Ethikerklärung der Richtervereinigung. Dort heißt es u.a: „Wir begegnen Verfahrensbeteiligten sachlich, respektvoll und äquidistant und gewähren ihnen ausgewogenes Gehör.“
Die öffentliche Kritik ist berechtigt. Das fallweise verwendete Argument, ohne Kenntnis des Aktes könne man ein öffentlich zitiertes Urteil nicht beurteilen, ist billig; es delegitimiert jede Kritik. Man muss auch nicht die Krankengeschichte kennen, um die irrige Amputation eines gesunden an Stelle eines verletzten Fingers zu rügen. Die Entwicklungen in Polen, Rumänien, der Türkei und Ungarn zeigen, wie wichtig die Unabhängigkeit der Gerichte und Richter ist. Diese Unabhängigkeit ist aber vor allem auch eine Verpflichtung der Richterschaft gegenüber der Bevölkerung.
Wenn Fehlleistungen wie im Grazer Urteil passieren, dann dürfen und sollen sie kritisiert werden – von innen und von außen.
Dr. Oliver Scheiber (* 1968) ist Richter in Wien; Leiter des Bezirksgericht Meidling. Der Text gibt seine persönliche Ansicht wieder.